Inhaltsverzeichnis
- Das erste Vorstellungsverfahren: Politische Entlastung im Schnelldurchgang
- Empörung in der Stadt – Zweites Vorstellungsverfahren
- Die Anfänge in der NS-Zeit
- Eintritt in die NSDAP 1937/ Vertreter der Fachschaft Artistik in der DAF
- Freundschaft mit Bürgermeister Heinrich Böhmcker
- Exkurs: Ein unschöner Vorfall im Astoria
- Exkurs: Skandal im Atlantic
- Entlastende Aussagen
- „Geschäftsnazi“ – Appeal not approved
- Eine tolldreiste Münchhausiade: Fritz als Widerstandskämpfer
- Doppelstrategie: Entnazifizierung in der britischen Zone
- Die zwei Leben des Emil Fritz
- Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch Befreiungssenator Aevermann
- Zweite Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch den Öffentlichen Hauptkläger Hollmann
- Der Vorsitzende der Spruchkammer Lindau blickt nicht mehr durch
- Diffamierungen und Verleumdungen – Die dunkle Seite des Emil Fritz
- Ein unbeirrbarer Zeuge: Willi Hasché
- Chronologie der Verfahren bis zum 15. Februar 1948
- Die Spruchkammer Lindau erteilt Fritz die politische „Absolution“ – Aufhebung des Urteils durch Napoli
- Neue Ermittlungen – Napoli veranlasst einen „D und E Report“
- Fritz im „D und E Report“ politisch belastet
- Napoli ordnet ein zweites Spruchkammerverfahren an
- Etappen von Fritz‘ NS-„Karriere“
Das erste Vorstellungsverfahren: Politische Entlastung im Schnelldurchgang
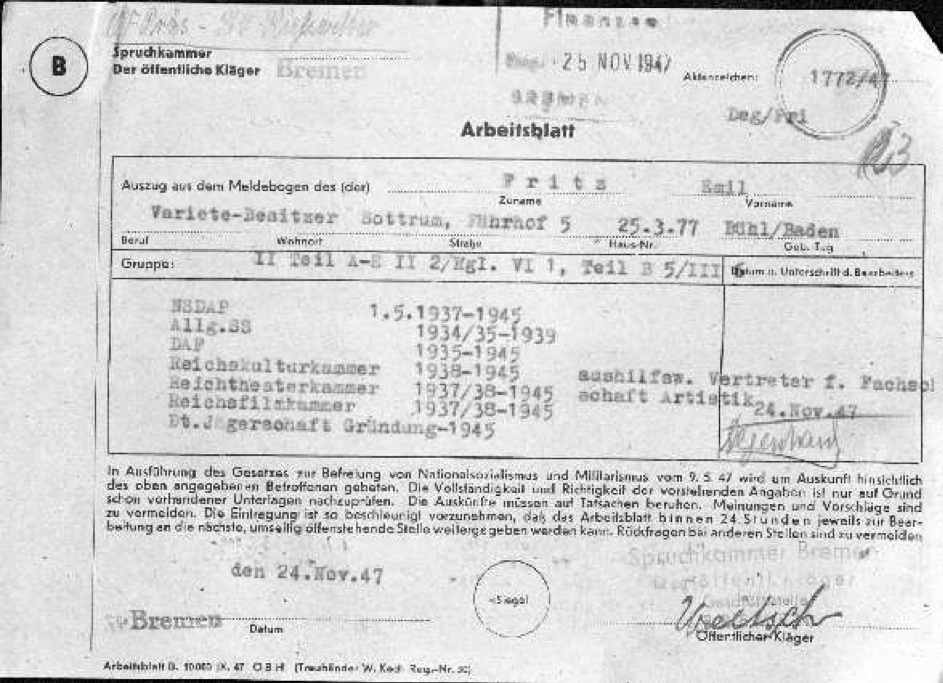
Das Gesetz Nr. 8 verlangte nicht nur „das generelle Verbot der Beschäftigung von Mitgliedern der NSDAP in einer anderen Stellung als der eines gewöhnlichen Arbeiters“, sondern räumte dem Betroffenen auch die Möglichkeit des Widerspruchs ein. In Absprache mit der amerikanischen Militärregierung wählte die Erste Bremische Bürgerschaft[43] am 29. Oktober 1945 einen 45-köpfigen Entnazifizierungs-Prüfungsausschuss für den Bereich der Privatwirtschaft,[44] der seinerseits acht Unterausschüsse zur konkreten Bearbeitung der Einzelfälle bildete. Auf Wunsch der Amerikaner waren sie ausschließlich mit Deutschen besetzt. In sogenannten Vorstellungsverfahren wurde darüber entschieden, ob ein Betroffener wirklich „beschäftigungs-unwürdig“ oder vielleicht doch „beschäftigungs-würdig“ wäre. Fritz hatte sein Vorstellungsverfahren am 20. Dezember 1945 beantragt. Sein Fall wurde vor dem Untersuchungsausschuss I unter Vorsitz von Hermann Krause verhandelt.
[43] Ihre Mitglieder waren von Bürgermeister Kaisen am 6.4.1946 ernannt worden.
[44] Der 45-köpfige Prüfungsausschuss für die Privatwirtschaft setzte sich zusammen aus 16 Arbeitnehmervertretern, 16 Arbeitgebervertretern, sechs Anwälten und sieben Ärzten. Er bildete acht Unterausschüsse für die Einzelentscheidungen in den Vorstellungsverfahren. Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 41/42.
Seite 11
Krause war nicht Mitglied der NSDAP. [45] Trotzdem lief gegen ihn eine Untersuchung bei der Militärregierung wegen des Verdachts auf „Nutznießerschaft“ bei der Arisierung jüdischer Firmen. Das Verfahren zog sich über zwei Jahre hin. Im Untersuchungsbericht der Militärregierung vom 26. Februar 1948 hieß es: „Während der Nazizeit war er Mitglied von Aufsichtsräten, Beiräten und Arbeitsausschüssen von ca. 20 Unternehmen und Institutionen des Handels, der Industrie und der Banken.“[46] 14 Aufsichtsräten gehörte er 1945 an. Fast alle hatte er während des Krieges übernommen.[47] Er stand im „Ruf, der befähigtste Bankfachmann Bremens“ zu sein.[48] 1932 war er Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, 1937 der Norddeutschen Kreditbank geworden..[49] Er war als Finanzfachmann so gut,dass er es sich sogar hatte leisten können, eine direkte Aufforderung von Bürgermeister Böhmcker, der Partei beizutreten, zu ignorieren, wie er dem „Investigator“ erklärte,[50] denn er hatte eine eigene, quasi bankkaufmännische Methode im Umgang mit den führenden Nationalsozialisten entwickelt: „ Meine Strategie war, viel Geld zu verdienen. Je mehr Einfluss ich auf die Wirtschaft hatte, umso mehr buckelten diese Parteibonzen vor mir.“[51] Im Bericht des „Investigators“ heißt es dazu: „Sein Einfluss in der Wirtschaft während der Nazizeit spricht sehr für seine bankfachliche Fähigkeit. Es kann daraus aber auch der Schluss gezogen werden, dass Krause von den parteiamtlichen Stellen nicht als ein ausgesprochener Gegner der Naziwirtschaftspolitik angesehen wurde.“[52] Seine Firmenbeteiligungen während des Krieges hatten sich, so der Bericht vom 26. Februar 1948, „sehr nutzbringend für ihn ausgewirkt.“. Sein Einkommen war in der Tat in dieser Zeit sprunghaft gestiegen: 52.000 RM in 1939; 63.000 in 1940; 218.000 in 1941; 156.000 in 1942; 112.000 in 1943.[53]
[45] Krause war in der führenden Kaufmannsschicht Bremens vor dem Krieg fest verankert; als Mitglied im Haus Seefahrt, im Club zu Bremen, im Club zur Vahr und als Eiswettgenosse. Vgl. den Fragebogen in seiner Entnazifizierungsakte vom 11.12.1945. StAB 4,66-I-5983.
[46] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.
[47] Eigene Angaben auf dem Fragebogen vom 11.12.1945, a.a.O.
[48] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.
[49] Eigene Angaben auf seinem Fragebogen vom 11. Dezember 1945, a.a.O.
[50] Selbst wenn es zu dieser Aufforderung durch Böhmcker gekommen sein sollte, wäre es Krause ohne weiteres möglich gewesen, ihn von der Erfolglosigkeit des Ansinnens zu überzeugen, denn er war Mitglied der Freimauerloge „Anschar zur Brüderlichkeit.“ Die Mitgliedschaft in Freimaurerlogen war unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der NSDAP. Bezeichnenderweise führte er seine Logenmitgliedschaft in der umfangreichen Liste seiner Mitgliedschaften im Fragebogen vom 1l.12.1945 nicht an.
[51] Erklärung in englisch für den englischsprachigen Bericht des „Investigators“ vom 1. März 1946: „My aim was to earn money. I have nothing to conceal. (…) I was struggling hard in the quiet against the Nazis. To gain a counter-weight, I decided to earn money. The more my influence economics grew, the more bent became the backs of those bigshots.” A.a.O.
[52] Bericht des „Investigators“ vom 26.2.1948, a.a.O.
[53] Eigene Angaben im Fragebogen vom 1. 12.1945, a.a.O.
Seite 12
Der Fall Krause sorgte in Bremen lange für Unruhe. In den Akten liegen zwei voneinander unabhängige anonyme Schreiben. Die Verfasser warfen Krause vor, „die besten Beziehungen zu allen führenden Nazis“ gehabt zu haben. Einer der Verfasser forderte seine sofortige Entfernung aus dem Vorstand der Norddeutschen Kreditbank. Das zweite Schreiben vom 1. Juli 1948 war an den Senator für Politische Befreiung, an den Öffentlichen Kläger und an Napoli, den amerikanischen Verantwortlichen für die Entnazifizierung in Bremen, gerichtet. Darin wurde behauptet, dass Krause in Jugoslawien und Österreich große Werte angehäuft hätte durch den billigen Erwerb jüdischer Firmen und durch Gewinnentnahmen im großen Umfang, die er nach Deutschland geschafft hätte. Den dargestellten Fakten nach hatte ihn ein „Insider“ des Bankmilieus geschrieben, der sich nicht zu erkennen gab, weil er selbst belastet war, wie er schrieb. Keiner dieser Vorwürfe konnte nachgewiesen werden. Der Verdacht, dass sich Krause direkt an Arisierungen beteiligt hatte, konnte nicht bestätigt werden.[54] Feststellen ließ sich lediglich, dass er 1939/40 Eigentümer von 25% Aktienanteilen (im Wert von über einer Million Reichsmark) einer „arisierten“ österreichischen Firma bei niedrigem Kursstand geworden war. Die Entnazifizierungsakte von Hermann Krause ist unvollständig. Die Dokumente von 1948, einschließlich Urteilsspruch und Begründung fehlen in der Akte. Aus seiner Nachkriegskarriere geht aber zwingend hervor, dass er 1948 als entlastet eingestuft worden sein muss.[55] Die Tatsache, dass er nicht Mitglied der NSDAP war, reichte, um ihn als politisch geeignet für die Tätigkeit eines Untersuchungsausschuss-Vorsitzender in einem Vorstellungsverfahren für die Privatwirtschaft einzusetzen.
Seit Anfang November 1945 hatte Fritz Briefe an ehemalige Angestellte und Lieferanten geschrieben, in denen er seine Absicht ankündigte, bald ein neues Astoria in Bremen zu eröffnen und in denen er um die Bestätigung dafür bat, dass er mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatte. Unter den Antworten war eine eidesstattliche Erklärung seiner Sekretärin Toni Paßmann vom 25. November 1945. Sie gab an, dass sie seit 14 Jahren als Sekretärin in den Emil-Fritz-Betrieben tätig war, also seit 1931. Sie bezeugte, „dass Herr Fritz als Betriebsinhaber seit der Machtübernahme durch die Nazis zahlreiche Zusammenstöße mit allen für die Betriebe in Frage kommenden Dienststellen der Partei gehabt hat.
[54]„Krause was not directly concerned in the Aryanzation oft he Jewish departement store (Kaufhaus) Genegross. Bericht vom 21. Februar 1946, a.a.O
[55] Krause überstand Nationalsozialismus und Krieg als gemachter Mann. Er gehörte zu den 18 Eiswett-Genossen der ersten Stunde. 1955 war er neben seiner Tätigkeit als Generaldirektor der Norddeutschen Kreditbank Aufsichtsratsmitglied in neun weiteren Gesellschaften.
Seite 13
Zurückzuführen waren diese Zusammenstöße darauf, dass Herr Fritz der Partei von Anfang an ablehnend gegenüberstand.“[56] Tatsächlich hatte Frau Paßmann erst am 15. Juni 1933 ihre Tätigkeit bei Fritz aufgenommen.[57] Diese falsche Angabe wird im Verfahren noch eine wichtige Rolle spielen.
Zwei weitere entlastende Erklärungen – die wegen ihrer politischen „Reinwaschung“ damals schon ironisch „Persilscheine“ genannt wurden –, kamen nicht aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und auch nicht aus dem beruflichen Milieu. Sie seien hier im Wortlaut wiedergegeben, weil sie paradigmatisch für die zahlreichen „Persilscheine stehen“, die sich praktisch in allen Entnazifizierungsverfahren fanden. Es sind vorzugsweise Erklärungen von Pfarrern und Hausärzten. Der katholische Pfarrer H. schrieb am 8. November 1945:
„Bestätige hiermit, dass Herr Emil Fritz (…) mir seit vielen Jahren bekannt ist aus den Amtshandlungen, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, die ich in seiner Familie vollzogen habe. Er ist Mitglied der kath. Kirche und nicht ausgetreten. Aus gelegentlichen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, muss ich entnehmen, dass er den Kampf des Nationalsozialismus gegen Kirche, Christentum und Judentum nicht gebilligt hat.“ H. Dechant
Der praktische Arzt Dr. W. L. stellte am 9. November 1945 eine „Bescheinigung“ aus: „Herr Emil Fritz (…) ist mein Patient und einer meiner Bekannten seit ungefähr 1915 und ich habe mit ihm oft über alle Themen der Politik während des Krieges 1914/18 und 1939/45 und in der Zwischenzeit gesprochen, wo wir auch immer die Politik und die Führung der Nationalsozialisten kritisierten, war Herr Fritz immer sehr scharf in seinen Meinungen, welche immer antinazistisch waren. Er sagte mir immer, dass er nur um die Mitgliedschaft in der Partei deshalb eingekommen sei, um Schaden für sein Geschäft und seinen vielen Angestellten zu verhindern. Ebenfalls vergewisserte er mir oft, dass er, wenn er nicht in die Partei eingetreten wäre, sicherlich dauernde Schwierigkeiten mit den Parteiführern und der Naziregierung gehabt haben würde.“ Dr. W.L.
[56] Eidessstattliche Erklärung vom 25. November 1945. Dok 132.
[57] Vor dem Untersuchungsausschuss IV korrigierte sie auf Befragen ihre Angaben dahingehend, dass sie erst seit dem 15.6.1933 bei Fritz tätig war. Appeal not approved vom 16. 8.1946. Dok 83.Troztdem wiederholte sie ihre Falschaussage später noch einmal in einer eidessstattlichen Erklärung (!) vom 4. November 1946, wo sie eine 15jährige Tätigkeit für die E.-F.-Betriebe angab. Dok 144, Anl.3.
Seite 14
Dass Krause das Verfahren gegen Fritz leitete, ist vermutlich kein Zufall. Es gab ja keinen Geschäftsverteilungsplan wie in richterlichen Verfahren. Es ist also durchaus denkbar, dass Krause das Verfahren gegen Fritz an sich gezogen hat. Der Untersuchungsausschuss I mit drei Beisitzern und dem Vorsitzenden Hermann Krause entschied auf den Sitzungen vom 21. und 25. Februar 1946 „nach Aktenlage“. Als einziger Zeuge trat Emil Fritz in eigener Sache auf. Der Spruch lautete: „Der Antragsteller war nur dem Namen nach Nationalsozialist und hat sich nicht aktiv für die Tätigkeit der NSDAP, bzw. einer Gliederung eingesetzt.“ „Der Unterausschuss kam zu der Feststellung, dass dem Antrag stattzugeben ist.“ In der Urteilsbegründung hieß es: „Die beiden vornehmsten Vergnügungsstätten“ – Astoria und Atlantic – hätten „schon vor dem Hitler-Regime“ im Interesse der Öffentlichkeit gestanden. „Es ist verständlich, dass die Hitler-Anhänger vom Jahre 1933 ab ihre besondere Aufmerksamkeit auf diese Betriebe richteten und ihre Nazifizierung forderten. Fritz‘ Kontakte zu den Bremer Nationalsozialisten wären berufsbedingt notwendig gewesen. Was die Mitgliedschaft in der NSDAP anging, so erschiene jedem „der sich zu jener Zeit aus Berufsgründen der unmittelbaren Berührung mit den Prominenten der Partei nicht entziehen konnte“ glaubhaft, dass er der Partei lediglich beigetreten wäre, „weil er die Zerschlagung oder die Übernahme seiner Betriebe durch K.d.F. [58] nur auf diese Weise verhindern konnte (…) Aus dem Gesamtverhalten des Herrn Fritz gegenüber den Partei-Würdenträgern (…) und aus dem Umstand, dass Herr Fritz als Katholik „von Anfang an einen weltanschaulich unverrückbaren Standpunkt hatte (…) ergibt sich (…) dass Herr Fritz nur dem Namen nach Nationalsozialist war ( …).“ Sein später Eintritt in die Partei 1938 (tatsächlich 1937 – d. Verf.) wäre in Wirklichkeit das Ende eines jahrelangen hartnäckigen Widerstandes gewesen. Die Nazis hätten „die Festung (das Astoria – d. Verf.) 4 Jahre lang vergeblich berannt.“ Das Urteil des Ausschusses endete mit der Erklärung, dass es einen noch triftigerer Grund für die weitere Tätigkeit von Fritz als Varieté-Direktor gäbe: „Hinzu kommt, dass es, wenn allenthalben zur Mitwirkung am Wiederaufbau aufgerufen wird, inkonsequent und unbillig wäre, einem Manne die Unterstützung zu versagen, der noch im Alter von 68 Jahren den Willen und den Mut aufbringt, nochmals von vorne anzufangen und seine total zerstörten Betriebe, die dem Ausspann und der Erholung der Menschen gedient haben und hoffentlich wieder dienen können, neu erstehen zu lassen. Der Arbeitsausschuss hat es nicht für vertretbar gehalten, einen Mann von solcher Tatkraft nur deshalb als beschäftigungsunwürdig zu bezeichnen, weil die Willkürherrschaft der vergangenen Zeit auf keinem Gebiet einen Widerstand duldete.“[59]
[58] KdF – Kraft durch Freude. Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront DAF. Größter
Reiseveranstalter im „Dritten Reich“.
[59] „Feststellungsergebnis in dem Vorstellungsverfahren des Herrn Emil Fritz, wohnhaft Bremen, Franklin D. Roosevelt-Boulevard 109 hat der Prüfungsausschuss (Untersuchungsausschuss Nr. I) … in der Sitzung vom 21. Und 25. Februar 1946 festgestellt: „Der Antragsteller war nur dem Namen nach Nationalsozialist und hat sich nicht aktiv für die Tätigkeit der NSDAP, bzw. einer Gliederung eingesetzt.“ Es folgt die Begründung. 4 Unterschriften. Dok 3.
Den Namen Franklin D. Roosevelt-Boulevard hatte die Straße erst am 18. Mai 1945 erhalten. Am 6.Juni 1939 war sie anlässlich der Rückkehr der „Legion Condor“ aus dem spanischen Bürgerkrieg in ihrem südlichen Teil vom Stern bis zum Eisenbahntunnel (damals „Spanischer Platz“) in Franco-Allee¸ in ihrem nördlichen in „Legion-Condor-Straße“ umbenannt worden. Vgl. Zwölf Jahre Bremen 1933-1945. Eine Chronik von Fritz Peters, hrsg. von der Historischen Gesellschaft Bremen. Bremen 1951. Am 17. Dezember 1945 erhielt sie in ihrer ganzen Länge wieder ihren alten Namen „Parkallee“. Vgl. Zwölf Jahre Bremen 1945 – 1956, a.a.O. S.10.
Seite 15
Das war das Credo, mit dem Krause auch seine eigene Entnazifizierung erfolgreich betrieben hatte. Über diesen politischen Gleichklang mit Fritz hinaus wurden hier handfeste Interessen von Krause als Banker erkennbar. Die Hypotheken, die er Fritz als Bankier Ende der zwanziger Jahre gewährt hatte, lasteten noch schwer auf den Grundstücken. Allein auf der Knochenhauerstraße 6/7 lag noch eine Schuld von 600.000 Reichsmark (die nach der Währungsreform in eine sogenannte Umstellungsgrundschuld von 540.000 RM umgewandelt wurde. Vgl. das Kapitel über den Wiederaufbau des Astoria). An die Bedienung der Hypotheken war nur zu denken, wenn Fritz wieder in das Varieté-Geschäft einsteigen würde. Es ist daher verständlich, dass der ehemalige Direktor des Theaters im Astoria, Georg Meyer, den Vorsitzenden des Unterausschusses I für befangen hielt. Als er am 7. Februar 1946 von seiner Vernehmung als Zeuge im Fall Emil Fritz nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau: “Da stimmt etwas nicht.“ Er sagte in einem späteren Verfahren aus, dass Krause nicht nur als Bankdirektor langjährige Geschäftsverbindungen zu Fritz unterhalten hätte, sondern dass er auch ein Freund der Familie Fritz und häufiger Gast im Astoria gewesen wäre.[60] Tatsächlich war Krause, wie Fritz in einer Vernehmung bestätigte, einer der beiden Bankdirektoren, die 1926 und 1928 über seine Hypotheken für das Astoria und das Café Atlantic entschieden hatten. Dabei handelte es sich um die schon genannte Summe von insgesamt einer Million Reichsmark.[61]
Empörung in der Stadt – Zweites Vorstellungsverfahren
Mehr noch als die Tatsache der politischen Entlastung, sorgte ihre Begründung in der Stadt für Aufsehen.
[60] Seine Aussage fehlte 1948 in der Akte der Spruchkammer, die erneut in Sachen Fritz ermittelte. Meyer wiederholte sie aber später gegenüber den Ermittlern Hölscher und Zarga im „D und E Report“ vom 7.4.1948.
[61] Angabe von Emil Fritz bei seiner Vernehmung vor der Spruchkammer am 9. August 1946. Dok 89.
Seite 16
Wili Ewert, Mitglied der Bremer Bürgerschaft[62] und des 45-köpfigen Prüfungsausschusses, wandte sich schriftlich an dessen Vorsitzenden.[63] Er hätte, schrieb er am 11. März 1946, „dauernd telefonische Anrufe, die ihre Entrüstung“ über diese Entscheidung zum Ausdruck bringen.“ Glaubwürdige Zeugen hätten in der Kriegszeit beobachtet, „dass Bürgermeister Böhmcker und Genossen schon vor jedem Alarm zu Fritz in das Sommerhaus (sein Jagdhaus in Sottrum – d. Verf.) gefahren seien, um dort den Alarm und den Angriff, weitab von jeder Gefahr und bei nicht schlechten Speisen und Getränken zu erleben.“[64] Ein derartiges Verhalten wäre „dem Herrn Fritz zuzutrauen, da sein Gewerbe ihn schon immer veranlasste, mit den Menschen, die gerade an der Reihe waren, seine Betriebe aufzusuchen auf dem allerbesten Fuße stand.“ Den Vorwürfen gegen Fritz müsste nachgegangen werden, weil Fritz „im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht“.[65] Ewert hatte sich schon einmal am 26. Februar an das Büro für Vorstellungsfragen gewandt. [66] Als Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses im Feststellungsverfahren gegen Georg Meyer, dem ehemaligen Direktor der Emil-Fritz-Betriebe, der seit 1933 Mitglied in der NSDAP war, hatte er von dessen Vorwurf an Fritz erfahren, „dass er Meyer zum Eintritt in die NSDAP gezwungen habe.“[67] Auch die KPD schaltete sich am 11. März mit einem Schreiben an das Büro des Prüfungsausschusses ein, in dem sie um die Vernehmung von drei Angestellten der Emil-Fritz-Betriebe ersuchte: Amandus Völk, Direktor seit 1941, Arthur Scheibner, Kapellmeister und Nanny Halfmann, zwanzig Jahre lang Buchhalterin.[68]
[62] Ewert wurde im November 1946 Wohnungsbausenator. Aus gesundheitlichen Gründen trat er im April 1948 zurück.
[63] Dessen Name fand ich nicht in der einschlägigen Literatur.
[64] Bis zu Böhmckers Tod am 16. Juni 1944 erlebte Bremen 122 Luftangriffe.
[65] Brief vom 11. März 1946 an das Büro für Vorstellungsfragen. E-Akte Fritz StAB, Nummer des Dokuments unleserlich.
[66] Dok 105.
[67] Meyer, geb. am 10.9.1891, war die Betriebserlaubnis für die Hanseaten-Stuben in der Katharinenstraße 14 entzogen worden, die er seit dem 1.10.1936 betrieben hatte. Er machte am 10. November 1945 folgende Aussage (in Auszügen): „Kurz vor dem Umsturz 1933 versuchten Himmler und mehrere Parteigenossen in Uniform Zutritt zu einer Abendvorstellung des „Astoria“ zu erlangen. Der Portier, der von mir strenge Anweisung bekommen hatte, keine Parteimitlieder in Uniform zuzulassen, meldet mir dieses. Als ich hinzugerufen wurde, fragte mich Himmler in barschem Tone, weshalb ihm und seinen Herren der Eintritt verweigert würde. Ich erklärte ihm, dass ich Schwierigkeiten befürchtete und verweigerte ihm weiterhin den Zutritt. Darauf verließ er mit seinem Stabe laut schimpfend und unter der Androhung: „Das soll Sie teuer zu stehen kommen“ die Gaststätte. Am anderen Tage wurde ich von meinem Arbeitgeber aus diesem Grunde gekündigt. Nur durch Vermittlung einiger „Astoria“-Stammgäste wurde ich schließlich in meiner Stellung belassen. Herr Fritz forderte mich dann auf, als sein Direktor im Interesse seines Unternehmens und aufgrund des Vorfalles mit Himmler, in die Partei einzutreten. Er selbst war zu dieser Zeit schon förderndes Mitglied der SS. (…) ich hatte meine Frau in Berlin und meine jetzige Frau und Tochter zu ernähren. Deshalb sah ich mich, um meine Stellung nicht zu verlieren, gezwungen, in die Partei einzutreten.“ Vorstellungsgesuch an den Prüfungsausschuss für Vorstellungsgesuche, Handelskammer Bremen vom 10. November 1945. StAB 4,66-I.-7308, Dokument ohne Ziffer. Den Vorfall mit Himmler bestätigte die damalige Garderobenfrau des „Astoria“, Justine Dziwisch, in einer eidesstattlichen Erklärung vom 25.3.1946.Himmler mit mehreren Herren, alle in SS-Uniform, Einlass ins „Astoria“ zu bekommen.. Im „Astoria“ hatten Parteiuniformierte durch eine Anordnung Direktor Meyers keinen Zutritt und der Portier, Herr W. L. verwehrte daher den Herren den Einlass, worauf diese randalierten und Himmler den Portier fragte, wer das angeordnet hätte.“ Man holte Meyer, der Himmler erklärte, „dass er die Herren in Uniform nicht ins Lokal lassen könne (…) Hierauf verließen die Herren unter lautem Schimpfen und Drohungen das „Astoria“. In Begleitung von Himmler befanden sich die Brüder Löblich. StAB.. a.a.O. ohne Bezifferung.
[68] 11. März 1946. Es werden als Zeugen benannt: Amandus Völk, letzter Direktor der E.-F. Betriebe, Arthur Scheibner, ehemaliger Kapellmeister und Frau Halfmann, Kassiererin. Die ersten beiden wurden vernommen. Die Kassiererin trat im Verfahren nicht auf.
Seite 17
Der Prüfungsausschuss beim „Headquarter Office of Military Government for Bremen – Detachement E2C2“ “ entschied am 16. März mit seinem deutschen Vorsitzenden, dass Fritz als nur „nomineller Nazi“ einzustufen sei. Die Prüfung war in einem Fragebogen zusammengefasst. In der Rubrik „Politische Vergangenheit“ stand die Frage 14: „Welche anderen Tatsachen weisen auf eine Zusammenarbeit mit oder seine Sympathie für die NSDAP oder ihre Lehren hin?“ Die Antwort war: „keine“. Ob die neuen Zeugenmeldungen den Ausschuss nicht erreichten oder dieser sie nicht für relevant hielt, ist nicht in den Akten vermerkt. Man verwies auf die Begründung des Unterausschusses I vom 25 Februar. Eine Kategorie des Fragebogens war, ob der Betroffene unersetzbar wäre. Dort stand unter Punkt 7, dass es „unmöglich wäre“, für den „Varietéfachmann“ Fritz Ersatz zu finden.“ Fritz hatte in seinem Schreiben an Kaisen vier Wochen zuvor richtig vermutet, dass er „in ganz kurzer Zeit“ als „nominelles“ Parteimitglied eingestuft und für „beschäftigungswürdig“ erklärt würde.
Dagegen hielt es der Vorsitzende des 45-köpfigen Entnazifizierungs-„Prüfungsausschusses“ „nach Durchsicht der Akten und aufgrund der neu eingegangenen Beschuldigungen gegen Herrn Emil Fritz für notwendig, dass das Verfahren erneut zur Verhandlung kommt. Ich bitte insbesondere, bei der neuen Behandlung der Akte die des Herrn Georg Meyer, der ebenfalls ein Vorstellungsverfahren hatte, hineinzuziehen.“[69] Er übertrug das Verfahren dem Untersuchungsausschuss IV, dessen Vorsitzender Carl Katz war[70], Leiter der Israelitischen Gemeinde Bremen[71]. Wann der Ausschuss genau seine Arbeit aufgenommen hat, erschließt sich nicht aus der Akte. Diese enthielt eine Vielzahl von Entlastungs- und Belastungsmaterial. Er traf seine Entscheidung aber nicht im schriftlichen Verfahren, wie das der Untersuchungsausschuss I getan hatte, sondern lud zahlreiche Zeugen für die mündliche Verhandlung vor. Wir wissen auch nicht, wie viele Verhandlungstage dafür nötig waren, bis der Abschlussbericht am 19. August fertiggestellt war.[72]
[69] Das Schreiben des Prüfungsvorsitzenden, dessen Unterschrift unleserlich ist, trägt kein Datum. Dok 104.
[70] Katz wurde am 6. Juni 1946 von der ersten (noch von Kaisen ernannten) Bremer Bürgerschaft in den
neunköpfigen Hauptausschuss für Entnazifizierung gewählt. Unter dessen Mitgliedern waren Oskar Schulze
(SPD), Willi Ewert (SPD) und Hermann Prüser (KPD), die alle drei für eine konsequente Entnazifizierung eintraten.
Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 50/51.
[71] Anfang 1933 lebten 1314 Juden in der Stadt; im Mai 1939 waren es nur noch 684; 1948 betrug ihre Zahl 98.
Vgl. Hans G. Jansen / Renate Meyer-Braun, Bremen in der Nachkriegszeit 1945 – 1949, Politik – Wirtschaft –
Gesellschaft. (In der Reihe „Bremen im 20. Jahr von Peter Kuckuk und Karl Ludwig Sommer), Unterkapitel
„Die Rückkehr der überlebenden Juden, S.205/208. Dort finden sich auch einige Angaben zum Schicksal der
Familie Katz in der Zeit des Nationalsozialismus.
[72] Ein langes Schreiben von Fritz vom 28. Mai deutet darauf hin, dass dies der Beginn der Untersuchung war.
Seite 18
Die Anfänge in der NS-Zeit
Zunächst ging es um die Frage ging, ob Fritz von Anfang an auf Konfrontationskurs zu den neuen Machthabern gegangen war, wie er das behauptete und ob ihm daraus tatsächlich die größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten erwachsen waren.[73] Der Untersuchungsausschuss I war ja davon ausgegangen, dass „die Hitler-Anhänger“ vom Tag der Machtübertragung an die „Nazifizierung“ des Astoria und des Atlantic gefordert hätten, ohne zu definieren worin diese bestanden hätte. Fritz wiederholte seine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss IV: Die Nazis „haben mir nur Schwierigkeiten gemacht (…) und mir im Übrigen laufend mit der Schließung der Betriebe gedroht.“[74] Nun lag dem Untersuchungsausschuss IV eine neue Zeugenaussage für die unmittelbare Zeit vor und nach der Machtübertragung vor. Es war die eidesstattliche Erklärung von Jane Schuhmann, die vom 26. September 1932 bis zum 25. Juni 1933 als Sekretärin der E.-F.-Betriebe tätig war, bevor Toni Paßmann sie ablöste. Nach ihrer Aussage vom 12. März 1946 hatte Direktor Meyer „sehr unter der Einstellung des Inhabers Emil Fritz zu leiden. Letzterer sympathisierte sehr mit den Nazis.“[75] Wichtige Zeugen in dieser Frage waren zwei ehemalige leitende Angestellte der Emil-Fritz-Betriebe: Willi Hasché, vom September 1932 bis Mai 1934 Generaldirektor[76] und Georg Meyer, der von 1930 bis 1936 das Astoria- Kabarett leitete und für die Artistenauswahl verantwortlich war.[77] Hasché sagte unter Eid aus, dass Fritz „ab November 1932 laufend Geld für den Wahlfonds der NSDAP an Standartenführer Laue spendete. Nach dem 30.1. war er außer sich vor Freude und brüstete sich mit den Quittungen vor jedermann.“[78]
[73] Der Untersuchungsausschuss Krause hatte die Namen der Personen aufgelistet, die Fritz bedrängt hätten, seine Betriebe zu „nazifizieren“: „Betriebszellenobmann, D.A.F., K.d.F., Staatsrat v. Hagel, Staatsrat Schwenck und nicht zuletzt der Gauleiter.“ Dok 3..
[74] Schreiben vom 28. Mai 1946. Dok 29.
[75] Eidesstattliche Erklärung vom 12. März 1946. In der Entnazifizierungsakte von Georg Meyer findet sich die folgende Aussage von Willi Hasché: „Herr Meyer habe ihm des öfteren sein Leid geklagt, dass Herr Emil Fritz ihn bedrängt habe, in die NSDAP einzutreten, welches mit Rücksicht auf seine Stellung denn auch tat.“ StAB 4,66-I.-7308.
[76] Willy Hasché wurde 1936 Direktor des Europa-Hotels am Herdentorsteinweg 49/50, das er bis in die Nachkriegsjahre leitete. Hasché trat im Januar 1938 in die NSDAP ein und musste sich einem Entnazifizierungsverfahren unterwerfen. Vgl. StAB 4,66-I.-4144.
[77] Meyer machte sich 1936 mit den „Hanseaten-Stuben“ in der Katharinenstraße 14 selbstständig.
[78] Eidesstattliche Aussage vor dem Untersuchungsausschuss im Entnazifizierungsverfahren gegen Georg Meyer am 19.7. 1946. E-Akte Meyer. StAB 4,66-I-7308. Ohne Nummerierung.
Seite 19
Jane Schuhmann bestätigte diese Aussage später im Spruchkammerverfahren vom April 1948. Sie hätte Ende 1932 „zusammen mit Fritz einen größeren Geldbetrag von über 1000.- RM nach dem Senator Laue- Alten Eichen – gebracht“[79]. Fritz hätte ein SS-Abzeichen getragen. „Er sagte, dass das SS-Abzeichen mehr wert sei als das Parteiabzeichen.“ Am 17. Juli schickte Hasché dem Untersuchungsausschuss das Astoria-Programmheft vom 1.1.1934, das „in auffälliger Weise mit nationalsozialistischer Propaganda durchzogen (war).“ [80] Mit Zitaten aus Reden von Hitler, Goebbels, Röhm und Ley wurde darin „in erheblichem Maße Propaganda gemacht für Hitler und die Bestrebungen der NSDAP.“[81] Sichtbaren Aufschluss über die Anbiederung an die neuen Machthaber gab ein Foto.[82] Es zeigt das Atlantic am 25. August 1933 im Schmuck eines riesigen Hitler-Portraits. Das Bild – im Stil der damaligen Großplakate an Kino-Fassaden – war offensichtlich speziell für diesen Anlass und für diesen Ort gemalt. Vom Künstler frei gestaltet, trug es in großen Buchstaben die Unterschrift des Portraitierten, wie das bei Autogrammkarte von Filmstars Mode geworden war. Mit der Hakenkreuzfahne über dem Haupt des Verehrten, den seitlichen Zierstreifen und vor allem mit der Girlande, die das Ganze von allen Seiten umrahmt, ist das Arrangement nicht anders als eine Huldigung zu verstehen. Man muss sich das Ganze in Farbe vorstellen: rot und schwarz die Seitenstreifen, ebenso die stilisierte Fahnenfläche und ringsum das Grün der Girlande. Aber das war noch nicht alles: nachts wurde das Bild von einem Scheinwerfer angestrahlt.
Der enorme Aufwand, der hier betrieben worden war und nicht zuletzt die auf dem Dach zusätzlich angebrachte Hakenkreuzfahne wiesen auf einen besonderen Anlass hin. Es war das „Gebietstreffen der Hitler-Jugend in Bremen“ am 26./27. August 1933. Die Geste wurde von der Partei verstanden, wie aus der Reportage der Bremer Nachrichten vom 27. August hervorging: „Deutsche Jugend marschiert: Ganz Bremen bewies und wird es heute wieder beweisen, dass es aus vollem, ehrlichen Herzen an dem Fest einer tapferen, einer herrlichen deutschen Jugend teilnimmt.
[79] Aussage im „D und E Report“ vom 6. April 1948.
[80] „Appeal not approved“- Ablehnung des Antrags durch den Untersuchungsausschuss IV am 19. 8.1946. Dok 83.
[81] Die Broschüre hatte dem Untersuchungsausschuss I unter Krause noch nicht vorgelegen. Hasché hatte sie erst
Dem Untersuchungsausschuss IV am 17. Juli per Post zugeschickt. Dok 103. Die Ermittler Hölscher und Zalga kamen im „D und E Report“ aufgrund der Broschüre zu der Einschätzung, „dass Fritz es darauf angelegt hatte, mit den Führern der Partei in noch engere Fühlung zu kommen.“ Bericht vom 6. April 1948. Das Programmheft fehlt in der Fritz-Akte. Das Jubiläumsheft „Bremens Maxim. 25 Jahre Astoria“ vom April 1933, das sich im Lesesaal der Staatsarchivs-Bibliothek unter der Signatur Af- 217 befindet, enthält lediglich eine Werbe-Anzeige der „B.N.Z.“, der Bremer Nationalsozialistischen Zeitung.
[82] Georg Meyer stellte das Foto dem Untersuchungsausschuss IV im Vorstellungsverfahren Fritz im Juni/Juli zur Verfügung. Das geht aus der Entnazifizierungsakte von Georg Meyer hervor. StAB 4,66-I.-7308.
Seite 20
An einigen Stellen der Stadt grüßen über die Straßen gespannte Flaggentücher mit der Aufschrift „Bremen
grüßt die Hitler-Jugend!“ Am Café Atlantik-Kaffee (!) erregt das überlebensgroße Bild des Führers Adolf Hitler anerkennende Bewunderung.“[83]

[83] Bremer Nachrichten vom 27. August 1933
Seite 21
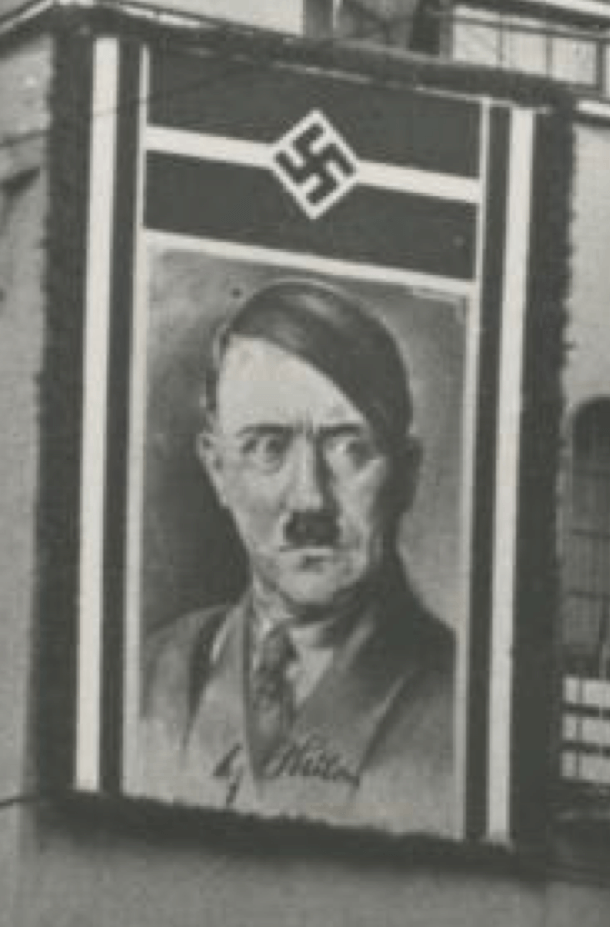
Seite 22
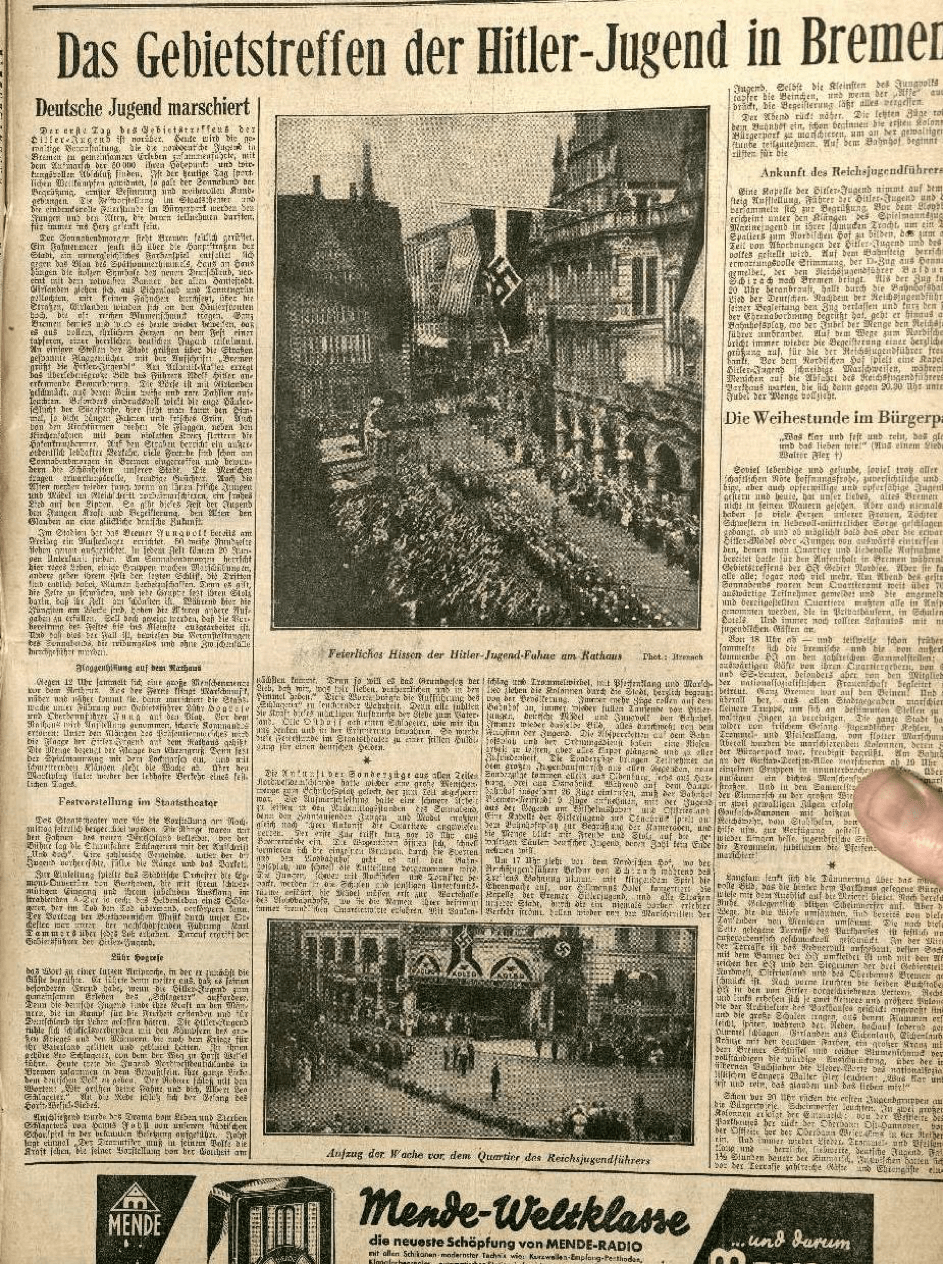
Das riesige Hitler-Portrait hat eine eigene Geschichte. Unmittelbar neben dem Atltantic lagen die Weinstuben Bardinet in der Knochenhauerstraße 4/5. Deren Eigentümerin, eine Frau Siemer, hatte im dritten Stockwerk ihres etwas zurückspringenden Hauses eine riesige Bremer Speckflagge angebracht.
Seite 23
Es nahm dem Hitler-Bild einen Teil seiner Wirkung und verhinderte, dass es nachts von dem extra zu diesem Zweck in einem der Nachbarhäuser angebrachten Scheinwerfer voll angestrahlt wurde. Fritz hätte, sagte Hasché als Zeuge aus, auf ihn und seinen Direktor-Kollegen Georg Meyer „furchtbar geschimpft, dass sie das Heraushängen der Siemer’schen Fahne nicht verhindert hätten.“[84] Auf das Geheiß von Fritz suchte Meyer mehrfach vergeblich die Bardinet-Weinstube auf, um die Abnahme der Fahne zu fordern. „Schließlich ließ Fritz (…) die SS-Standarte anrufen, dass sie sein Hitler-Bild schütze und die ihm lästige Fahne Siemers zwangsweise entferne.“[85] Was dann geschah, schilderte Frau Siemer in ihrer schriftlichen Aussage: „Am Abend kamen mehrere bewaffnete SS-Leute, geführt von (…) SS-Obersturmführer Piorkowski (…) Die SS-Leute stürzten in meine Wohnung und holten die Flagge selbst ein. Sie zerbrachen mir hierbei noch eine Marmortischplatte. Der Sieg wurde anschließend im Café Atlantic gefeiert.“[86] Fritz erklärte dazu, dass er mit dem Foto nichts zu tun gehabt hätte und dass dies Sache der Direktoren gewesen wäre. In Wirklichkeit hatte sich Fritz „die Ausschmückung der Betriebe selbst vorbehalten und er ließ sich darin auch nicht dreinreden.“ Das war die Aussage des zuverlässigen Zeugen Paul Wittig, des langjährigen Buchhalters der Emil-Fritz-Betriebe. Auf die Frage, wer das Hitlerbild seinerzeit angebracht hätte, erklärte Wittig, seines Wissens trug Fritz die Verantwortung über die Anbringung des Bildes am Haus Atlantic selbst.“[87]
Eintritt in die NSDAP 1937/ Vertreter der Fachschaft Artistik in der DAF
In der Begründung des Krause-Untersuchungsausschusses für Fritz‘ politische Entlastung war eine Person ausdrücklich mit Namen genannt worden, weil sie angeblich „die Festung vier Jahre lang vergeblich berannt“ hätte. Es war Staatsrat Gerhard von Hagel.[87] Er war Leiter der Bremer DAF-Organisation Hago (Dachorganisation der Nationalsozialistischen Handwerks-, Handels- und Gewerbeorganisationen).
[84] Eidesstattliche Erklärung von Hasché im Spruchkammerverfahren Georg Meyer vom 23. Juli 1946
Entnazifizierungsakte Georg Meyer StAB 4,66-I.-7308.
[85] A.a.O. In einer schriftlichen Aussage im Spruchkammerverfahren gegen Fritz vom 17. 1. 1948 wiederholte er diese Aussage: Fritz „alarmierte die SS-Standarte, um von dieser die bremische Fahne herunterholen zu lassen.“
[86] Schriftliche Aussage Siemer vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren gegen Fritz vom 27. Januar 1948. Dok fK3.
[87] „D und E Report“ vom 6. April 1948.
[88] Feststellungsergebnis. .a.a.O.
Seite 24
Die Hago war aus dem „NS Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand“ hervorgegangen, an dessen Spitze von Hagel gestanden hatte. Im August 1933 war sie in die Hago überführt worden, 1935 dann in die DAF (Deutsche Arbeitsfront). [89] Zur Rolle des von Hagel gab es in einem späteren Verfahren eine erweiterte Aussage von Fritz: „Bald nach der Machtübernahme hatte ich dauernd unter dem starken Druck der DAF[90] und KdF[91] zu leiden. Man versuchte mit allen Mitteln, mir die Betriebe abspenstig zu machen. (…)Staatsrat von Hagel gab sich alle Mühe, mein Geschäft schließen zu lassen.Offen wurde mit einem Boykott meiner Betriebe gedroht. Nicht nur mit dem Boykott, sondern man hat mir auch ganz deutlich gesagt, man werde gegebenenfalls nicht davor zurückschrecken, den Betrieb zu demolieren. (…) In Wirklichkeit habe ich seit der Machtübernahme einen erbitterten Kleinkrieg gegen das aufkommende Bonzentum und deren ungeheuerliche Forderungen geführt.“ [92]
Nach der Aussage von Hasché hatte Fritz dagegen gleich nach der Machtübertragung den Kontakt zur NSDAP gesucht, „insbesondere mit dem damaligen Staatsrat von Hagel als dem Leiter der NS-Hago.“[93] Fritz hatte bis 1933 dem „Internationalen Varieté-Theater und Zirkus-Direktor-Verband e.V. Berlin“ angehört, dessen Präsidium mit dem Juden Jules Marx an der Spitze, umgehend aufgelöst und durch Mitglieder der NSDAP ersetzt wurde und der im Rahmen der kulturellen Gleichschaltung 1934 aufgelöst und als „Fachschaft Artistik“ in die Reichskulturkammer überführt worden war. 1937 wurde er Vertreter der Bremer „Fachschaft Artistik“ in der DAF[94] und akzeptierte damit das Auftrittsverbot für jüdische Künstler in seinen Betrieben, eine Voraussetzung für die Aufnahme in die DAF. Im gleichen Jahr trat er in die NSDAP ein. Das eine wird ohne das andere nicht möglich gewesen sein. Der enge zeitliche Zusammenhang der beiden Ereignisse ist unübersehbar in einem Brief, den Fritz sechs Tage nach seinem sechzigsten Geburtstag am 25. März 1937 an Gerhard von Hagel geschrieben hatte. Form und Inhalt des Briefes lassen darauf schließen, dass seine NSDAP-Mitgliedschaft vorher erfolgt war oder dass er zumindest die Absicht dafür erklärt hatte. (Auszug) „Sehr geehrter Herr von Hagel! Ich habe mich wirklich außerordentlich gefreut, dass Sie an mich gedacht haben zu meinem 60. Geburtstag.
[89] wikipedia.org/wiki/ Stichwort: Nationalsozialistischer_Kampfbund_für_den_gewerblichen_Mittelstand.
[90] „Die Deutsche Arbeitsfront“ (DAF): Nachfolgeorganisation der der zerschlagenen Gewerkschaften, deren Vermögen sie übernommen hatte. Sie war der Einheitsverband von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.1934 wurde sie der NSDAP angeschlossen. Reichsleiter und „Führer“ war Robert Ley.
[91] „KdF – Kraft durch Freude“. Unterorganisation der Deutschen Arbeitsfront DAF. Organisierte Freizeitvergnügen für Arbeiter und Angestellte mit bunten Abenden und Konzerten zu niedrigen Eintrittspreisen. Am erfolgreichsten waren die Kreuzfahrten. Größter Reiseveranstalter von 1933 bis 1939.
[92] Aussage vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren am 23. Dezember 1947. Dok Nr. 12.
[93] Im Spruchkammerverfahren gegen Fritz am 17. Januar 1948. Dok K3.
[94] Eigene Angabe im Meldebogen vom 3. Juli 1947. Dok Nr. 1.
Seite 25
(…) Man sieht daraus wieder einmal, wie Ihnen die von Ihnen betreuten Betriebe am Herzen liegen. (…) Eine besondere Freude war es für mich, dass die Reichstheaterkammer mir die Ehre erwies und den Präsidenten und den Vize-Präsidenten der Fachschaft Artisten zum Gratulieren nach Bremen entsandte. Der Präsident Gleixner hat seine Gratulation im Namen der Reichstheaterkammer im Astoria vor dem Publikum bekanntgegeben[95] und wir haben dann den Abend noch in einer stimmungsvollen kleinen Feier mit den gesamten Künstlern beschlossen. Ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und grüße Sie mit Heil Hitler!“[96]
Am 25. März 1937 beglückwünschten ihn die nationalsozialistische Bremer Zeitung und die Bremer Nachrichten“ zu seinem 60. Geburtstag. Die Bremer Nachriten hoben hervor, „dass erals verantwortungsbewusster Betriebsführer seine Betriebe durch gute und schlechte Zeiten in enger Verbundenheit mit seiner Gefolgschaft und mit den von ihm betreuten Künstlern führte.“ Der Artikel in der Bremer Zeitung war von ähnlicher Aufmachung und Inhalt.
[95] Reichspropagandaminister Goebbels‘ hatte die Aufsicht über die Reichstheaterkammer, die ab 1936 in sieben Bereiche untergliedert war, in Rechts- und Nachrichtenfragen, Organisation, Opernreferat, Fachschaft Bühne, Fachschaft Artistik, Fachschaft Tanz und Fachschaft Schausteller. Die Fachschaft Artistik unter der Leitung von Albert Peter Leixner war wiederum in 6 Referate unterteilt. Referat 1 war zuständig für Betriebsführer und Direktoren. „Vize-Präsident“ war ein gewisser Hans Bauer. Vgl. wikipedia.org/wiki/Reichstheaterkammer
[96] Brief vom 31. März 1937 an Gerhard von Hagel. Dok 254.
Seite 26
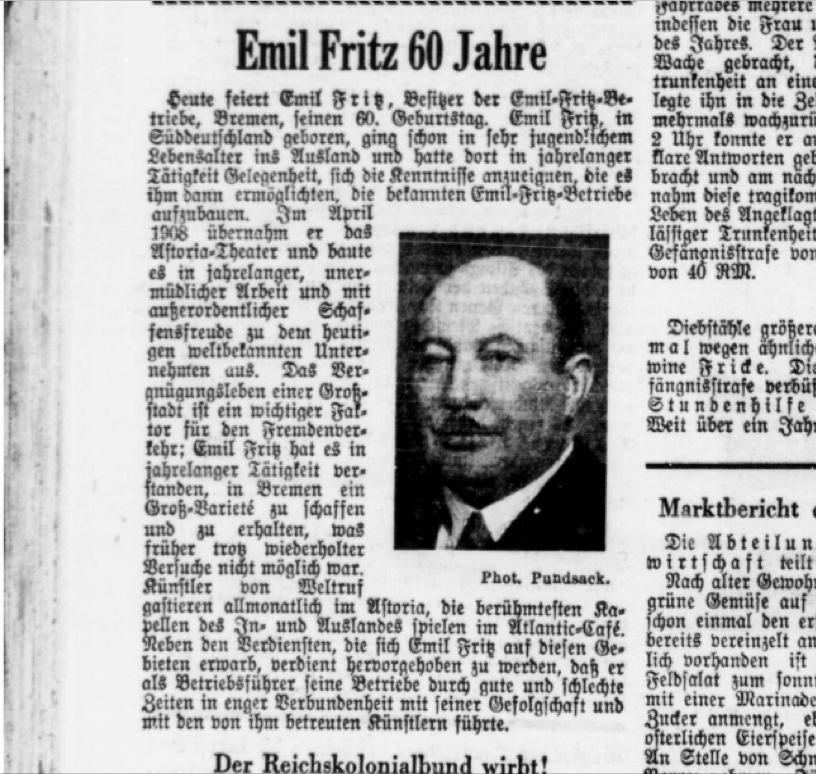
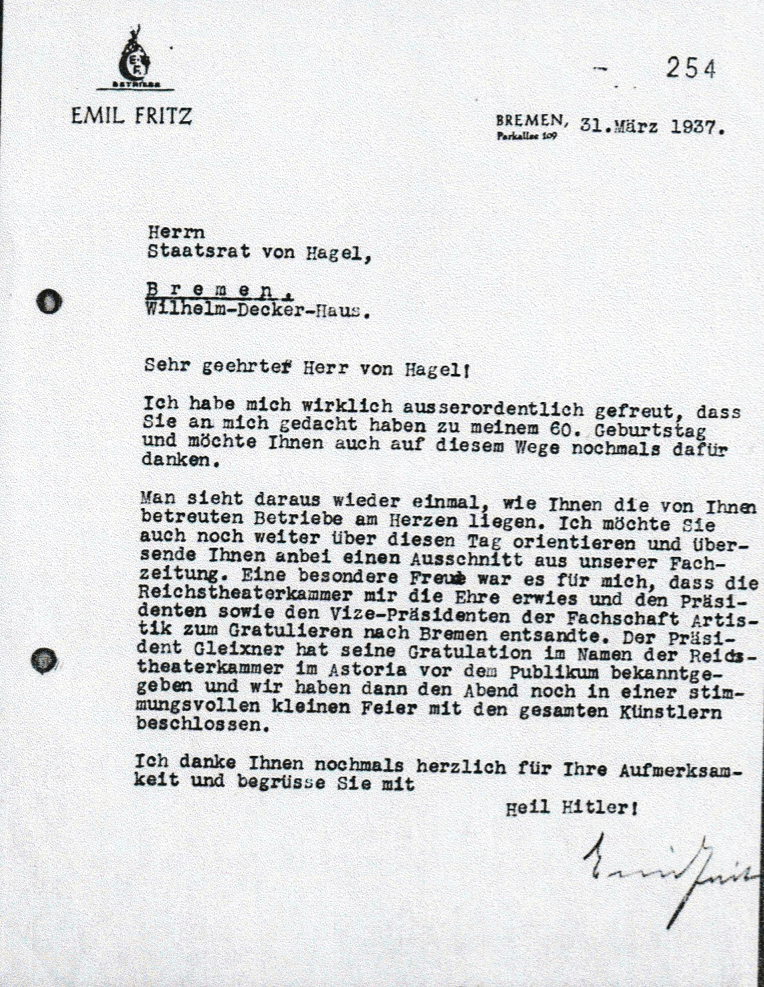
In einem zweiten Schreiben von Fritz an die DAF vom 28. April 1941 kam „die nationalsozialistische Betätigung des Antragstellers am klarsten“ zum Ausdruck, urteilte der Vorstellungsausschuss IV.[97] Hier berief sich Fritz ausdrücklich auf seine Funktion als Vertreter der Fachschaft Artistik. Dieser Brief widerlegte seine Aussage im ersten Meldebogen, dass er schon 1938 wieder „abgesetzt“ worden wäre.[98]
In diesem Schreiben beklagte er, dass er wieder nicht zu den ausgezeichneten Betrieben gehörte.[99]
[97] Appeal not approved vom 19. August 1946, a.a.O. Auch die Ermittler des „D und E Reports“ vom 7. April 1948 kamen zu diesem Ergebnis. Vgl. Kapitel III „Das Entnazifizierungsverfahren.“
[98] Vgl. „Appeal not approved“ vom 19. August 1946, Punkt 4. Dok 83.
[99] Es befindet sich nicht mehr in der Entnazifizierungsakte, stand aber den Ermittlern Hölscher und Zalga für ihren „D und E Report“ vom April 1948 noch zur Verfügung.
Seite 27
Dabei ging es um die Auszeichnung von DAF-Betrieben mit der „Goldenen Fahne“, die nur „nationalsozialistische Musterbetriebe“ führen durften.[100]
Dass die NSDAP-Freizeitorganisation (Kraft durch Freude) regelmäßig sonntags Veranstaltungen im Astoria durchführen konnte, dürfte in diesem Zusammenhang gestanden haben. Sie warfen wegen der vorgegebenen niedrigen Eintrittspreise keinen nennenswerten Gewinn ab.[101] Vom wirtschaftlichen Blickpunkt her war das kein Problem, denn über einen Mangel an Einnahmen hatte Fritz sich in den dreißiger Jahren nicht zu beklagen, im Gegenteil. Sie steigerten sich ununterbrochen von 1935 bis ins fünfte Kriegsjahr 1943 erheblich.[102]
Der Vorstellungsausschuss IV kam zu folgendem Ergebnis: „Vom Beginn des dritten Reiches an bis zum Schluss hat der Antragsteller freundschaftliche Beziehungen zu führenden NS-Personen gehabt. Dazu gehörten auch die übelberüchtigten Nazis wie Piorkowski (später Kommandant in Dachau)[103], Löblich, KZ- Kommandant in Bremen[104] sowie der Polizeipräsident Laue. Skatabende mit Oberbürgermeister Böhmcker waren jahrelang die Regel mit nachfolgenden Feiern. Mit den meisten dieser Nazis stand der Antragsteller auf dem Duzfuße und lud sie oft zur Jagd ein.“[105]
[100] Seit 1936 wurden von der Deutschen Arbeitsfront (DAF) jährlich Wettbewerbe um die „Bestgestaltung“ der Arbeitsplätze veranstaltet, der so genannte „Leistungskampf der deutschen Betriebe“. Die Betriebe, die beim Wettbewerb auf Reichsebene am erfolgreichsten waren, erhielten jeweils am 1. Mai von Hitler die Auszeichnung „nationalsozialistischer Musterbetrieb“ und durften die Goldene Fahne der DAF führen. Die Fahne war eine Hakenkreuzfahne, der weiße Kreis war mit einem goldenen Zahnrad umrahmt.“ Wolfgang Benz, Hermann Graml, Hermann Weiß (Hrsg.), Enzyklopädie des Nationalsozialismus Stuttgart 1998, S. 567
[101] Aussage des Buchhalters Paul Wittig am 28. November 1945. Dok 133.
[102] Vgl. das Kapitel über die Finanzierungsprobleme beim Wiederaufbau des Astoria.
[103] Alexander Piorkowski, *11. Oktober 1904 in Bremen; seit 1929 SA-Mann, ab 1933 SS-Standartenführer in Bremen; ab 1938 im Konzentrationslager Dachau tätig, seit 1942 dort Lagerkommandant; von einem amerikanischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 22. Oktober 1948 gehängt. https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Piorkowski.
[104] Otto Löblich, seit 1929 SA-Führer in Bremen, nahm an Saalschlachten teil. 1933 wurde ein Verfahren gegen ihn wegen der Erschießung des Reichsbannermannes Lücke niedergeschlagen, weil die Tat angeblich im nationalen Interesse begangen worden wäre. Er galt als „der Prototyp des harten, gewalttätigen SS-Führers; seit April 1933 war er SS-Sturmbannhauptführer. Im März 1933 wurde er Führer der Bremer Hilfspolizei und damit Leiter des Konzentrationslagers Mißler. Er wurde als SS-Führer abgesetzt, u.a. weil er „nach den Jahren des Kampfes“ nun den großen Mann spielte und weil „eine mangelnde Selbstdisziplin gegenüber dem Alkohol“ zeigte. Schwarzwälder, Herbert, Geschichte der Freien Hansestadt Bremen IV, Bremen in der NS-Zeit (33-1945), Erw. und verb. Aufl. 1995, S. 152/153. (1951 wurde ein Verfahren gegen ihn niedergeschlagen, weil die Tat verjährt war.)
[105] Appel not approved vom 19. August 1946. StAB, a.a.O., Dok 83. Eine Falschaussage zum Thema Treibjagd findet sich am 4. November 1946 in der „Eidesstattlichen Erklärung“ von Toni Paßmann. Sie gab an, dass Fritz „in den Jahren, in denen Böhmcker Bürgermeister in Bremen war, nur ein einziges Mal an einer von Böhmcker veranstalteten Treibjagd teilgenommen (hat).“ Böhmcker hat nie eine eigene Jagd besessen. Es war Fritz, der nach Sottrum einlud. „In den nachfolgenden Jahren hat Herr Fritz regelmäßig Einladungen zu den von Böhmcker veranstalteten Treibjagden erhalten. Ich habe alle diese Einladungen abschlägig beantwortet und Herrn Fritz mit den verschiedensten Krankheiten, die in Wirklichkeit nicht bestanden, entschuldigt. Herr Fritz hatte mir dem Sinne nach erklärt, dass er an keiner Treibjagd, die dieser Nazihäuptling veranstaltete, teilnehmen wolle. Er wolle mit dem System und seinen Hintermännern nichts zu tun haben.“ Dok 144, Anlage 3.
Seite 28
Freundschaft mit Bürgermeister Heinrich Böhmcker
Auch das zweite aussagekräftige Foto hatte dem Untersuchungsausschuss Krause wahrscheinlich nicht vorgelegen. Es zeigt die private Hochzeitsfeier von Emil Fritz im Oktober 1941in seiner Villa in der Legion-Condor-Straße 109 (heute Parkallee).[106] Zur Rechten der Braut sitzt als Ehrgengast der Regierende Bürgermeister Heinrich Böhmcker, festlich gekleidet. Zwei weitere Ehrengäste aus der ersten Riege Bremer Prominenz haben sich hinter dem Bürgermeister aufgestellt. Es sind Franz Stapelfeldt, Generaldirektor der DeSchimag/ AG Weser (Deutsche Schiff- und Maschinenbau Aktiengesellschaft), Vizepräses der Handelskammer, Wehrwirtschaftsführer, eine kaufmännische Größe der Stadt und Friedrich Deiters, Eigentümer der Norddeutschen Spinn- und Webstoff-Handelsgesellschaft, Mitglied der Jagdgesellschaft von Fritz in Sottrum, beide unmittelbare Nachbarn in der Parkallee. Das Geschirr ist noch unberührt. Die Stimmung scheint in Erwartung eines guten Essens entspannt und fröhlich, wie man an den Gesichtern der Brautleute und der übrigen Gäste sehen kann.

[106] Wer das Foto dem Ausschuss übergeben hat, erschließt sich nicht aus der Akte. Es scheint einem Fotoalbum entnommen worden zu sein. Auf jeden Fall war es ein Teilnehmer der Feier.
Seite 29
Eine Reihe von glaubwürdigen Zeugen bestätigte, dass die Hochzeitsfeier ohne besondere Vorkommnisse verlaufen wäre. Allen voran der Kaufmann Ferdinand Ahrens, einer der beiden Trauzeugen und Amandus Völk, der letzte Geschäftsführer der Emil-Fritz-Betriebe.[107] Auch Hermann Z., Kellner in den Emil-Fritz-Betrieben von 1931 bis 1943, der die Gäste während der ganzen Feier bedient hatte, bestätigte, dass Böhmcker kurz vor dem Essen gekommen wäre, an der Mittagstafel eine Ansprache gehalten hätte und bis zum Ende der Feier geblieben wäre, wobei er sich nicht auffällig benommen hätte. Die Feier wäre bis zum Schluss um 17 Uhr in ruhigen Bahnen verlaufen.[108] Die Hochzeitsfeier war einer von 14 Gründen, die den Untersuchungsausschuss dazu bewogen, den Antrag von Fritz abzulehnen.
Fritz war nicht bereit, diese unleugbaren Tatsachen zuzugeben. Er legte dem Untersuchungsausschuss seine eigene Geschichte vor: Böhmcker wäre „in betrunkenem Zustand in die Gesellschaft eingedrungen“ und er habe ihm deshalb „einen Faustschlag versetzt.“[109] Im Verlauf der weiteren Verfahren präsentierte Fritz noch zwei andere Versionen. In seinem Widerspruchs-Schreiben an die Militärregierung vom 4. November 1946 schrieb er: „Der frühere Bürgermeister Böhmcker ist zu meiner Hochzeit nicht eingeladen worden. Er hatte von irgendjemand gehört, dass ich Hochzeit hätte und ist dann, nachdem das Essen schon vorbei war und ich mit meiner Frau bereits die Vorbereitungen zur Abreise traf, unangemeldet in die Gesellschaft hineingeplatzt. Ich war darüber außerordentlich empört, konnte aber den Bürgermeister unserer Stadt nicht von meinem Tische weisen, weil ich mir damit das Todesurteil selbst gesprochen hätte.“ Ob Fritz diese Münchhausiade – und weitere – als solche empfunden oder sie selbst geglaubt hat, lässt sich nicht ohne weiteres sagen. Aber die Tatsache, dass er sich nicht mehr daran erinnerte, was er noch vor drei Monaten ausgesagt hatte und dass es ihm das offensichtlich gleichgültig war, lässt eher darauf schließen, dass er frei fabulierte. In dieser Aussage hieß es weiter: „Der anwesende Fotograf hat dann auch noch eine Aufnahme gemacht. Ich habe etwa ½ Stunde später die Festlichkeit zusammen mit meiner Frau verlassen. Kurze Zeit darauf hat sich der frühere Bürgermeister Böhmcker im Astoria so unmöglich benommen, dass ich ihn des Lokals verweisen musste. Böhmcker wurde tätlich gegen mich. Ich habe zurückgeschlagen. Er hat dann mein Lokal verlassen und ist niemals wieder in meinem Lokal als Gast erschienen.“ [110]
[107] „Appeal not approved“ – Begründung vom 19.August 1946. Dok 83
[108] Vernehmung am 13. August 1946.
[109] Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, zitiert aus der Begründung „Appeal not approved“. a.a.O.
[110] Schreiben an die Militärregierung – Review board branch. Dok 22.
Seite 30
Damit hatte er angeblich schon zum zweiten Mal sein Todesurteil gesprochen. Die dritte Variante der Geschichte, aufgenommen in eine eidesstattliche Erklärung von Sekretärin Toni Paßmann lautete: „Als das Essen schon vorbei war und Herr Fritz mit seiner Frau für die Hochzeitsreise zum Aufbruch rüstete, erschien plötzlich und unangemeldet der frühere Bürgermeister Böhmcker mit zwei oder drei Herren seines Gefolges. Er kam herein und sagte etwa dem Sinne nach: Ich komme gerade von einer Tagung und habe gehört, Fritz heiratet heute; da gibt es doch hier sicherlich was zu saufen! Die Festteilnehmer nahmen an der stehen gebliebenen Festtafel nochmals Platz. Herrn Böhmcker wurde noch etwas serviert. (…) Etwa eine halbe Stunde später verließ Herr Fritz mit seiner Frau das Fest. Er sagte zu mir: „Lass‘ den Bömcker man alleine saufen!“ Ich bin dann auch fortgegangen und habe mir am nächsten Tage von der Tochter von Herrn Fritz erzählen lassen (sic! – d.Verf), dass Böhmcker sich derartig betragen habe, dass die Festteilnehmer ihn hinausbefördert hätten.“[111] Damit nicht genug, erfand Fritz am 18. Dezember in seiner Aussage vor der Spruchkammer Lindau eine vierte Fassung, die dann als Entlastung in das Urteil aufgenommen wurde. [112] Dass Fritz sich mit allen Mitteln von dem Verdacht befreien wollte, je mit Böhmcker auf gutem Fuß gestanden zu haben, hatte gute Gründe. Johann Heinrich Böhmcker, der „Latten-Heini“, SA-Mann der ersten Stunde, seit dem 16. April 1937 Regierender Bürgermeister Bremens, hatte den Spitznamen von seinen brutalen Einsätzen bei Saalschlachten in der „Kampfzeit“.[113] Man wusste in Bremen, wes Geistes Kind er war.[114] Seine Rede, die er nach der Bremer Pogromnacht vom 9. Auf den 10. November 1938 im „Casino“ gehalten hatte und die in langen Auszügen in den Bremer Nachrichten veröffentlicht worden war, ist bis heute ein Schandfleck in der Geschichte der Stadt.[115] Böhmcker war am 16. Juni 1944 während einer Bahnfahrt gestorben. Die Partei hatte ihn mit einem Festakt in der oberen Rathaushalle geehrt.[116] Offensichtlich verleitete der Tod des Bürgermeisters Fritz zu seinen erfundenen Geschichten.
[111] Eidesstattliche Erklärung vom 4. November 1946. Dok 144, Anl. 3.
[112] Vernehmung am 18. Dezember 1947 in eigener Sache. Zwei Unterschriften, darunter Lindau. Dok 8. Das Urteil wird unten erörtert.
[113] Vgl. Inge Marßolek, René Ott, Bremen im 3. Reich. Anpassung – Widerstand -Verfolgung, Bremen 1986, S.131 und Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie 1912-1962, hrsg. Von der Historischen Gesellschaft zu Bremen und dem Staatsarchiv Bremen, bearbeitet von Wilhelm Lührs, Bremen 1969, S.57/58.
[114] Als Regierungspräsident im Freistaat Oldenburg hatte er kurz nach der Machtergreifung auf eigene Faust das KZ-ähnliche „Schutzhaftlager“ Eutin (später Ahrensbök) eingerichtet, aus dem sich vermögende Häftlinge freikaufen konnten.
[115] Dass sein Telefonanruf im SA-Hauptquartier in der Hollerallee in Bremen der unmittelbare Auslöser für das Pogrom in Bremen war, war damals in der Stadt nicht bekannt.
[116] Vgl. Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie 1912 – 1962, hrsg. Von der Historischen Gesellschaft zu Bremen und dem Staatsarchiv Bremen in Verbindung mit Fritz Peters und Karl H. Schwebel, bearbeitet von Wilhelm Lührs. Bremen 1969, S.58.
Seite 31
Aber die Spatzen pfiffen es von den Dächern, wie eng verbunden er mit dem Bürgermeister war. Es fehlte in den Vorstellungsverfahren nicht an glaubwürdigen Zeugen, die das bestätigten. Allen voran Buchhalter Paul Wittig, der Fritz im November 1945 bescheinigt hatte, dass die hohen Einnahmen in der nationalsozialistischen Zeit nicht im Zusammenhang mit irgendwelchen Verbindungen zu staatlichen oder Parteistellen entstanden waren. Als Zeuge von den Ermittlern als zurückhaltend beschrieben, sagte er im April 1948 aus, dass „alle Größen der Partei bei Fritz verkehrten“. NSDAP-Kreisleiter Blanke und Bürgermeister Böhmcker hätten „zu den intimsten Freunden“ von Fritz gehört. Sie wären häufig in Sottrum gewesen, wo sie „mit Fritz auf Jagd fuhren.“[117] Das bestätigte Frau „Siemer Wwe.“, Inhaberin der benachbarten Weinstuben Bardinet : Fritz wäre mit Böhmcker „sehr verwachsen gewesen“ und hätte besonders „mit den Nazigrößen“ verkehrt und „posiert“.[118] Auch der ehemalige Direktor Georg Meyer bestätigte diese Angaben in zwei Aussagen. „Emil Fritz war ein persönlicher Freund des verstorbenen Bürgermeisters Böhmcker. Trotzdem es allgemein bekannt war, dass gerade Böhmcker in Bremen die Judenpogrome veranlasst hat, wurde er von Fritz ständig zur Jagd eingeladen.“ Fritz hätte sich „wiederholt gebrüstet, der NSDAP anzugehören und Leiter der Fachschaft Artistik zu sein.“ [119] „Ins Astoria zog Herr Fritz in der Folgezeit die Nazis hinein, insbesondere solche, von denen er sich Vorteile versprach, wie den SS-Führer Löblich. Dieser terrorisierte recht oft die Gäste des Astoria, ohne dass Herr Fritz ihm Einhalt gebot.“ [120]
Exkurs: Ein unschöner Vorfall im Astoria
Auf Vorladung erschien am 20. Juli 1946 der Zeuge Otto Lütkens vor dem Untersuchungsausschuss IV und machte Aussage über einen Besuch im Astoria im März 1940:[121] „Ich saß in Gesellschaft meiner Freunde, Herrn Will S. und Herrn Dr. jur Fritz W, nach einem gemütlichen Abend nachts um 12 bi 1 Uhr im Astoria, wo wir den bereits angefangenen Abend eigentlich beenden wollten. In dieser gemütlichen Stimmung wurden wir durch das Erscheinen einer leicht beschwipsten Gesellschaft aufmerksam, weil sich unter ihnen ein Amtswalter in brauner Uniform befand.[122]
[117] „D und E Report“ der Ermittler Hölscher und Zalga vom 6./ 7. April 1948.
[118] A.a.O. Dass diese Zeugen hierzu erst im April 1948 noch einmal befragt wurden, lag an den
Versäumnissen der vorangehenden Untersuchungsausschüsse.
[119] Eidesstattliche schriftliche Aussage vom 29. März 1946 – Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV. Er
fuhr fort: „Im Vorraum seines Privatbüros hing über dem Kamin ein Paradebild der SS-Leibstandarte. (…) Er
hat mir beim Empfang des U-Boot-Kapitäns Hardegen in Bremen im Jahr 1944 erklärt, dass er diesen
Empfang mit 5000 RM finanziert habe.“
[120] Schreiben vom 17. Januar 1948 an den öffentlichen Kläger für das Spruchkammer-Verfahren, Dok K3.
[121] Dok 87.
[122] Amtswalter waren Amtsträger der NSDAP. Sie waren zuständig für die politische Überwachung, propagandistische Ausrichtung und weltanschauliche Schulung der Teile der Bevölkerung, die in der NSDAP organisiert war. Sie bildeten das „Korps der Politischen Leiter“, das zum Zweck der politischen Gleichschaltung eingesetzt wurde, nach militärischem Vorbild uniformiert und in Dienstränge eingeteilt. Sie waren auch Spitzel der NSDAP und überwachten die Bevölkerung, indem sie Karteikarten über die Bewohner ihres „Betreuungsgebietes“ anlegten. Wegen ihrer braunen Uniform wurden sie im Volksmund „Goldfasane“ genannt. 1937 umfasste die Gruppe 700.000 Personen. Wikipedia Stichwort „Politische Leiter“.
Seite 32
Die Leute setzten sich uns gegenüber an einen Tisch und ich konnte mir die Bemerkung meinen Freunden gegenüber nicht versagen, dass doch Leute wie Amtswalter in Uniform, noch dazu in so später Abendstunde, ein Lokal wie das Astoria besser meiden sollten, um ihren „Volksgenossen“ ein Beispiel zu sein. (…) Es entspann sich ein kleiner Wortwechsel, wo wir dann als Akademiker, Plutokraten und dergleichen betitelt wurden, wir aber aus unserer anti-braunen Einstellung keinen Hehl machten. Der Amtswalter stand auf und wollte mich sprechen, worauf ich das ablehnte mit dem Bemerken, dass er ja morgen früh in mein Büro kommen könnte und gab ihm meine Visitenkarte.“ Der Amtswalter sagte, dass er halb dienstlich hier sei, um die in seiner Begleitung befindlichen Seeleute zu betreuen. „Er verbat sich jegliche Einmischung unsererseits, worauf ich ungefähr mit den Worten antwortete, er solle sich man schnell umziehen, dann würde er bestimmt von uns in Ruhe gelassen. Es trat dann auch wirklich Ruhe ein. Bis auf Betreiben des Amtswalters, der sehr eindrücklich auf einen der Seeleute einredete, der plötzlich aufsprang und von mir erst bemerkt wurde, wie er vor mir stand und mir im selben Augenblick einen Stuhl über den Kopf schlug. Ich brach blutüberströmt zusammen, war kurze Zeit bewusstlos und fand mich im Nebenraum wieder, wo sich der Geschäftsführer des Astoria um mich kümmerte. Der herbeigerufene Besitzer des Lokals, Emil Fritz, kam auf mich zu und machte ungefähr die Bemerkung (…): Jetzt sind Sie endlich aufgelaufen mit Ihrer Einstellung, da haben Sie ja selbst Schuld.“ Der Zeuge wurde ins Krankenhaus gebracht und erstattete Strafanzeige gegen den Schläger.[123]
Was Fritz und Böhmcker verband, war ihre Jagdleidenschaft. Schon vor dem 1. Weltkrieg hatte Fritz eine Jagd in Sottrum/Kreis Rotenburg gepachtet. Nicht weit davon entfernt, auf dem Fährhof 5, hatte er 1919 ein Wochenend-Jagdhaus erbaut. Hierhin lud er zu Treibjagden ein, seit 1937 auch den Regierenden Bürgermeister Heinrich Böhmcker. Fritz‘ Eintritt in die NSDAP hat den engen Kontakt der beiden Männer sicher nicht unwesentlich beschleunigt. Hier begegneten sich zwei Männer, die aus dem gleichen Holz geschnitzt waren. Rigorose Naturen, denen die Ausübung von Gewalt, wenn auch in verschiedenen Ausprägungen, nicht fremd war.
[123] Der zweite Zeuge Will S. hatte diesen Vorfall schon in einer eidesstattlichen Erklärung am 1. November 1945
im Entnazifizierungsverfahren von Georg Meyer geschildert. Dort ohne Nummerierung.
Seite 33
Für Böhmcker war die Ausübung physischer Gewalt ein Begleiter seines Lebens. Bei Fritz war es die Freude an der Macht, die ihm als Alleinherrscher über 200 Menschen in seinem kleinen Imperium zur Verfügung stand. Beide Herren waren dem Alkohol nicht abgeneigt, feierten gern und spielten Karten. Sie waren vermutlich das, was man loyale Kumpel nennen kann. Herbert Schwarzwälder kommt fast ins Schwärmen, wenn er von der „anderen Seite“ des Heinrich Böhmcker erzählt: „In seinem Privatleben“, heißt es, wäre er „Juden gegenüber tolerant gewesen (…), wie er überhaupt im Grunde seines Wesens gutmütig und rücksichtsvoll war, nur nicht die Kraft besaß, den äußeren Verhältnissen und vor allem dem Alkohol gegenüber genügend Widerstand zu leisten.“[124] Allerdings, räumt Schwarzwälder ein, konnte er „in Auseinandersetzungen … sehr ausfallend sein.“ Und das galt auch für Emil Fritz. Dreimal haben war Fritz in Schilderungen erlebt, die ihn, bzw. seine unmittelbare Umgebung in angeblichen Auseinandersetzungen mit der Faust sehen. Es werden noch weitere hinzukommen.
Exkurs: Skandal im Atlantic
Auf ein entspanntes Verhältnis von Partei und Fritz deutet ein dramatischer Vorfall vom April 1941 hin, über den der Bremer Historiker Herbert Schwarzwälder in seiner Geschichte der Freien Hansestadt Bremen berichtet. Der Bremer Polizeipräsident SS-Oberführer Oberg „hatte eine sehr forsche Art, wurde aber gleich zu Beginn seiner Amtszeit im April 1941 in einen Skandal verwickelt. Im Café Atlantic in der Knochenhauer Straße, das mit einem Tanzboden und einer kleinen Kabarett-Bühne ausgestattet war, hielten sich oft „zweifelhafte Damen“ auf. Hin und wieder gab es polizeiliche Kontrollen. Im April genehmigte der Leiter der Kripo, Oberregierungsrat König, eine größere Razzia, die durch einen Kriminalkommissar durchgeführt wurde. Der neue Polizeipräsident Oberg wünschte selbst daran teilzunehmen; er riss dann die Führung des ganzen Unternehmens an sich. Zahlreiche Frauen wurden ins Polizeihaus befördert, dort einer ärztlichen Zwangsuntersuchung ausgesetzt. Viele Betroffene und ihre Angehörigen protestierten umgehend, darunter auch eine nahe Verwandte von Rudolf Heß. Staats- und Parteistellen befassten sich mit der Angelegenheit. Oberregierungsrat König wurde beurlaubt. Am 20.4.1941 traf der Chef der Reichskriminalpolizei, Artur Nebe, in Bremen ein; König und ein Kriminalkommissar wurden nach Berlin transportiert und dort verhört, beide aus Bremen versetzt. Polizeipräsident Oberg wurde ebenfalls abgesetzt.“ [125]
Dem Atlantic-Café hat es nicht geschadet.
[124] Herbert Schwarzwälder, Bremische Biographie, a.a.O., S.58.
[125] Herbert Schwarzwälder. Geschichte der Freien Hansestadt Bremen IV, a.a.O. S. 398/399. Wie in seinem ganzen Werk, finden sich bei Schwarzwälder keine Quellenangaben. Carl Oberg wurde zuerst nach Schwerin, dann in das Generalgouvernement (Polen) versetzt, wo er verantwortlich war für die Verhaftung von Juden und polnischen Zwangsarbeitern. Im Mai 1942 wurde er als höherer SS- und Polizeiführer nach Paris versetzt, wo er an der „Endlösung der Judenfrage“ beteiligt war. Der „Schlächter von Paris“ war aktiv an der Zerstörung der Altstadt von Marseille beteiligt und an der Deportation von Hunderten von Juden und anderen Franzosen in die Vernichtungslager. In Frankreich zum Tode verurteilt, 1958 zu lebenslanger Haft, 1962 von de Gaulle begnadigt und aus französischer Haft entlassen. https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Oberg
Seite 34
Entlastende Aussagen
„Als gläubiger Katholik und auch aus innerer politischer Feindschaft (hatte ich) keinerlei Bindungen zur Partei.“ (In der Vernehmung des öffentlichen Klägers am 23. Dez. 1947 Dok „zu 12“). Fritz „stellte Zahlungen an die Partei „absolut in Abrede“, räumte aber gleichzeitig ein, „dass es sich um kleine Beträge (handelte), „an die ich mich nicht erinnere.“ (Aussage vor dem Untersuchungssauschuss IV am 9. August 1946. Dok 89) Was die Ausschmückung des Atlantic mit dem Hitler-Portrait anging, so hatte die NSDAP ihm verlangt, „dass die zur Propaganda geeignete Fläche meines Atlantic-Betriebes mit einem großen Hitler-Bild geschmückt würde. (…) Ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt.“ (Widerspruchs-Schreiben an die Militärregierung Bremen 4. November 1946. Dok „zu 22“.)
Was die Programmzeitschrift vom 1.1.1934 anbetraf mit den Reden führender Nationalsozialisten, so wäre nicht er dafür verantwortlich gewesen, sondern Direktor Hasché. (Aussage in der Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren am 29. 12.1947. Dok 9).
Die strategische Linie, die Fritz in seinem Schreiben an Bürgermeister Kaisen vom 22. Januar 1946 eingeschlagen hatte und die im ersten Vorstellungsverfahren des Untersuchungsausschusses I erfolgreich war, setzte er in einem Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV vom 28. Mai fort und erweiterte sie mit einem Blick auf Hamburg „Trotz meines Alters, der Zerstörung meiner Betriebe und der schweren Schicksalsschläge, die mich betroffen haben, habe ich den Mut, meine Betriebe erneut aufzubauen, um den allgemeinen Wünschen der Bevölkerung, die täglich an mich herangetragen werden, nachzukommen (…) und um Bremen als neuem Einfuhrhafen Deutschlands und als Konkurrenz zu Hamburg auch auf dem Gebiete des Vergnügungslebens wieder an erste Stelle zu bringen.“[126] Das war schlau, wie sich noch herausstellen würde, denn der Bremer Senat wird sich letztlich auch wegen der Konkurrenz zu Hamburg für den Wiederaufbau des Astoria entscheiden.
[126] Brief vom 29.5.1946. Dok 29.
Seite 35
Dem Schreiben fügte Fritz am nächsten Tag eine schriftliche Ergänzung bei mit Aussagen zu seinem ehemaligen Kapellmeister Scheibner und dem letzten Direktor der Emil-Fritz-Betriebe Amandus Völk, die er beide persönlich angriff: „Die Verdächtigungen des Zeugen Scheibner kann ich als richtig nicht anerkennen. Herr Scheibner ist absolut unzuverlässig.“ „Die Aussagen von Völk sind im Wesentlichen unwahr. Völk hat sich als absolut unzuverlässig entpuppt.“[127] Völk hatte in Sachen Fritz schon Anfang 1946 „verschiedene Eingaben an den Bürgermeister gemacht“, die merkwürdigerweise Fritz sofort ausgehändigt worden waren, bzw. spurlos „verschwanden.“[128]
In den folgenden zwei Jahren entwickelte sich ein zäher Kampf. Die Emil-Fritz-Betriebe gab es im Mai 1946 schon wieder, wenn auch zunächst nur als Briefkopf, in dem die Göbenstraße 16 als Büro angegeben war.[129] Das war die Wohnung von von Toni Paßmann, der alten und neuen Sekretärin der Emil-Fritz-Betriebe.[130] An der ungewöhnlichen Schreibschrift-Type konnte man erkennen, dass nicht nur ihre Schreiben und die Briefe von Fritz, sondern auch die eidesstattlichen Erklärungen von Buchhalter Paul Wittig, dem Hausmeister Erich K. und von den dreißig Angestellten auf ihrer Maschine getippt worden waren.[131]
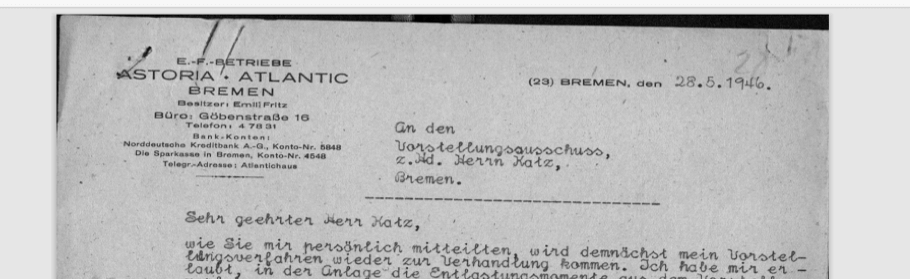
Sie legte dem Ausschuss am 6. März eine Liste mit 30 Unterschriften von „ausnahmslos langfristig in den Betrieben tätigen Angestellten der
[127] Schreiben an den Untersuchungsausschuss IV vom 29. 5.1945. Dok 32.
[128] Schreiben der Stadtleitung der KPD an den Untersuchungsausschuss IV vom 11. März 1946. Völk bestätigte diese Angaben in seiner Vernehmung vor den Investigatoren des“D une E Reports“ am 6. April 1948.
[129] Das geht aus einem Antwortschreiben des Präsidenten der „Internationalen Artisten-Loge Hamburg“,O’Leary, an Fritz vom 18.12.1945 hervor, der auf seinen Brief vom 10. 12. Bezug nimmt.
[130] Aus den lückenhaften Angaben im Bremer Adressbuch jener Zeit ergibt sich, dass Toni Paßmann mit Ehemann Heinrich, einem kaufmännischen Angestellten, hier von 1942 bis 1964 wohnte, wahrscheinlich schon viele Jahre vorher. Ihr Mann war Mitglied der NSDAP. Ab 1950 firmiert die Adresse Toni Paßmann unter Künstler-Agentur.
[131] Brief von Fritz an Kaisen am 22. Januar 1946. Eidesstattliche Erklärungen von Toni Paßmann am 25. November 1945, von Paul Wittig am 28. November 1945, von den dreißig ehemaligen Angestellten am 6. März 1946 und von Erich K. am 6.8.1946.
Seite 36
Emil-Fritz-Betriebe“ vor, die „an Eidesstatt“[132] erklärten, „dass die Geschäftsführung und Herr Emil Fritz im Besonderen sich um die politische Einstellung seiner Angestellten niemals bekümmert hat.“[133]
Beim Ausschuss ging nun eine große Zahl von Schreiben ein, in denen die Zeugen im Wesentlichen aussagten, dass ihnen nichts bekannt geworden war, dass Fritz politisch belastete. Darunter waren Emigranten, wie der Conférencier Rolf Romany, Personen aus Artistenverbänden wie der Hamburger O’Leary oder Firmen, deren Dienstleistungen die E.-F.-Betriebe in Anspruch genommen hatten wie der Artisten-Vermittler C. Schwarz, die Dekorationsfirma H, Borgstedt, und der Masseur F. Kienert, die Fritz aus dem persönlichen Umgang eine nichtnationalsozialistische Einstellung bestätigten. Später kam der Wein- und Spirituosenhändler F. Kayser dazu.
„Geschäftsnazi“ – Appeal not approved
Wie der Untersuchungsausschuss IV zusammengesetzt war, erfahren wir aus den Akten nicht. Er hatte sich fast ein halbes Jahr Zeit gelassen, bevor er den Abschlussbericht am 19. August mit der Ablehnung des Antrags abschloss: „Appeal not approved“. Er hatte zahlreiche Entlastungs-, bzw. Belastungsschreiben und Dokumente überprüft. Die zeitaufwändigste Arbeit war die Vernehmung der zahlreichen Zeugen. Aus den Akten geht nicht hervor, wie viele Sitzungen dafür nötig waren. Auf einer Liste mit 14 Punkten begründete der Ausschuss im Einzelnen, warum er den Antrag von Fritz auf Freigabe seines Vermögens und auf Erteilung der Gewerbeerlaubnis als Varieté-Direktor ablehnte.[134] Auszug: „Vom Beginn des dritten Reiches an bis zum Schluss hat der Antragsteller freundschaftliche Beziehungen zu führenden NS-Personen gehabt.“ „Die Propaganda an Gebäuden und in den Programmheften, die Hochzeitsfeier mit SA-Obergruppenführer Böhmcker als Gast und Festredner sind unzweideutige Beweise für die nationalsozialistische Betätigung des Antragstellers. Am klarsten kommt das im Schreiben an die DAF vom 28.4.41 zum Ausdruck. (…) Die große Anzahl von Entlastungsschreiben, sowie die Vernehmung von etlichen Angestellten des Antragstellers haben die zahlreichen Belastungen nicht entkräften können.
[132] Die zahlreichen „eidesstattlichen“ Erklärungen im Gesamtgeschehen der zwei Jahre sind fast nie von einem Notar legitimiert und daher von keiner besonderen rechtlichen Relevanz. Sie waren eher ein „Kampfmittel“, das von beiden Seiten benutzt wurde.
[133] Liste vom 6. März 1946. Die Namensliste ist in der Akte unvollständig. Die Zahl von 30 wird in einer dreiseitigen Auflistung aller Dokumente genannt, die bis etwa Mitte Januar 1947 Eingang in die Akte Fritz gefunden hatten. Sie zählt 197 Dokumente auf. Die Zusammenstellung selbst hat kein Datum und keine Nummerierung.
[134] „Appeal not approved.“, a.a.O.
Seite 37
Die Entlastungszeugen können nicht als völlig unbefangen angesehen werden. So sind Schreiben von Emigranten wegen der zeitlichen und räumlichen Entfernung zu bewerten, weil sie nicht aus eigenen Beobachtungen wissen können, was sich in der Zwischenzeit in Bremen ereignete. (…) Etliche Belastungszeugen wurden gar nicht mehr herangezogen.“ Viele Angaben von Fritz erschienen „unglaubwürdig.“ „Die Verschmelzung mit der NS-Politik“ hätte ihren Niederschlag „in den steigenden Einnahmen“ gehabt. „Der Antragsteller muss als ein typischer Geschäftsnazi angesehen werden.“ Zum Schluss hieß es: „Bei der Vernehmung legte der Antragsteller ein Photoalbum mit Widmungen von amerikanischen Offizieren vor und äußerte dabei, dass die Amerikaner ihn besser kennten als andere Leute.“[135] Eine unfreiwillige Pointe in Anbetracht der Tatsache, dass die Militärregierung die Ablehnung seines Antrags bestätigen wird.
[135] Der Bericht fährt fort: „Dazu muss aber auf die Auskunft der Information Control Branch, Intelligence Section vom 9.2.1946 hingewiesen werden.“ Es ist anzunehmen, dass dieser Bericht eine der Grundlagen für das Verfahren gegen ihn war.
Seite 38
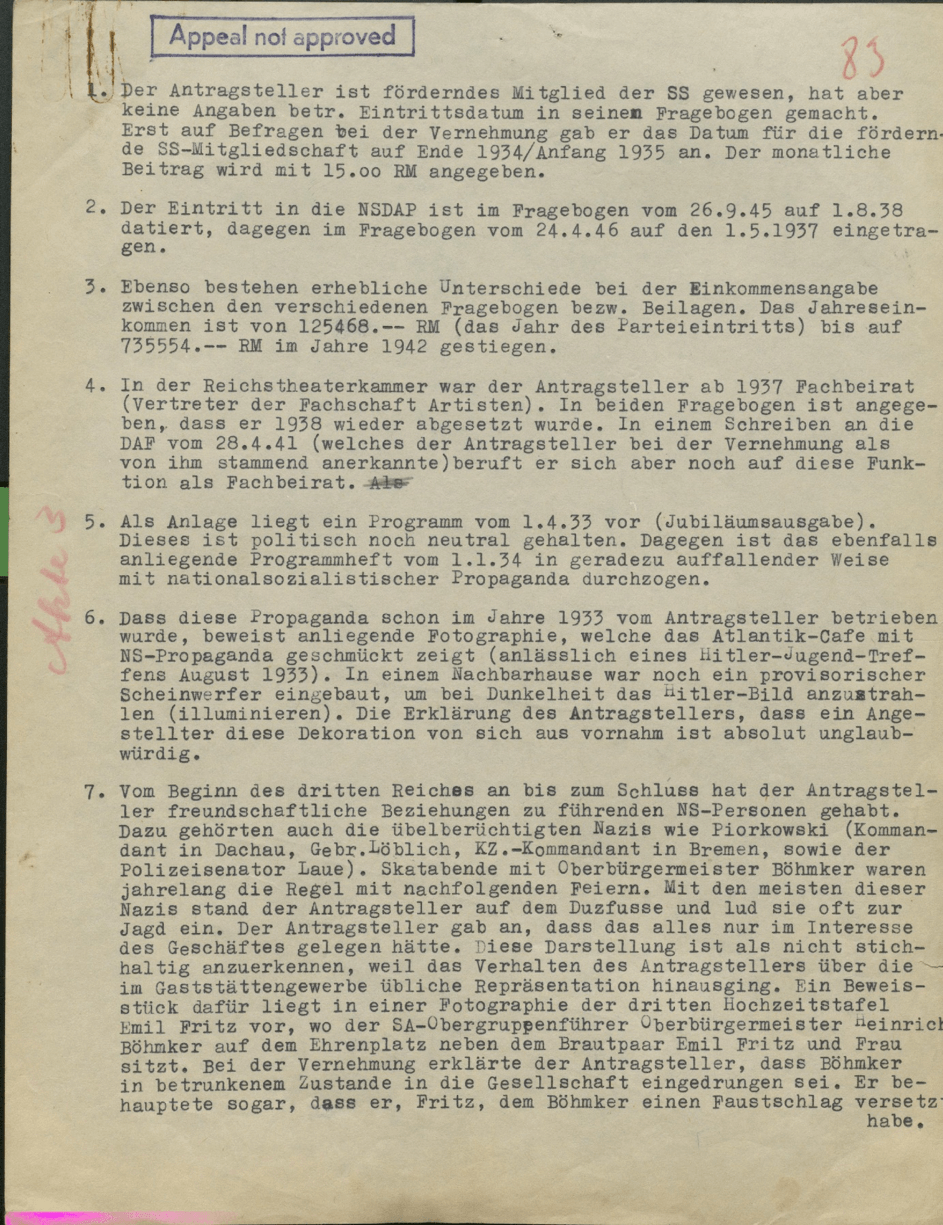
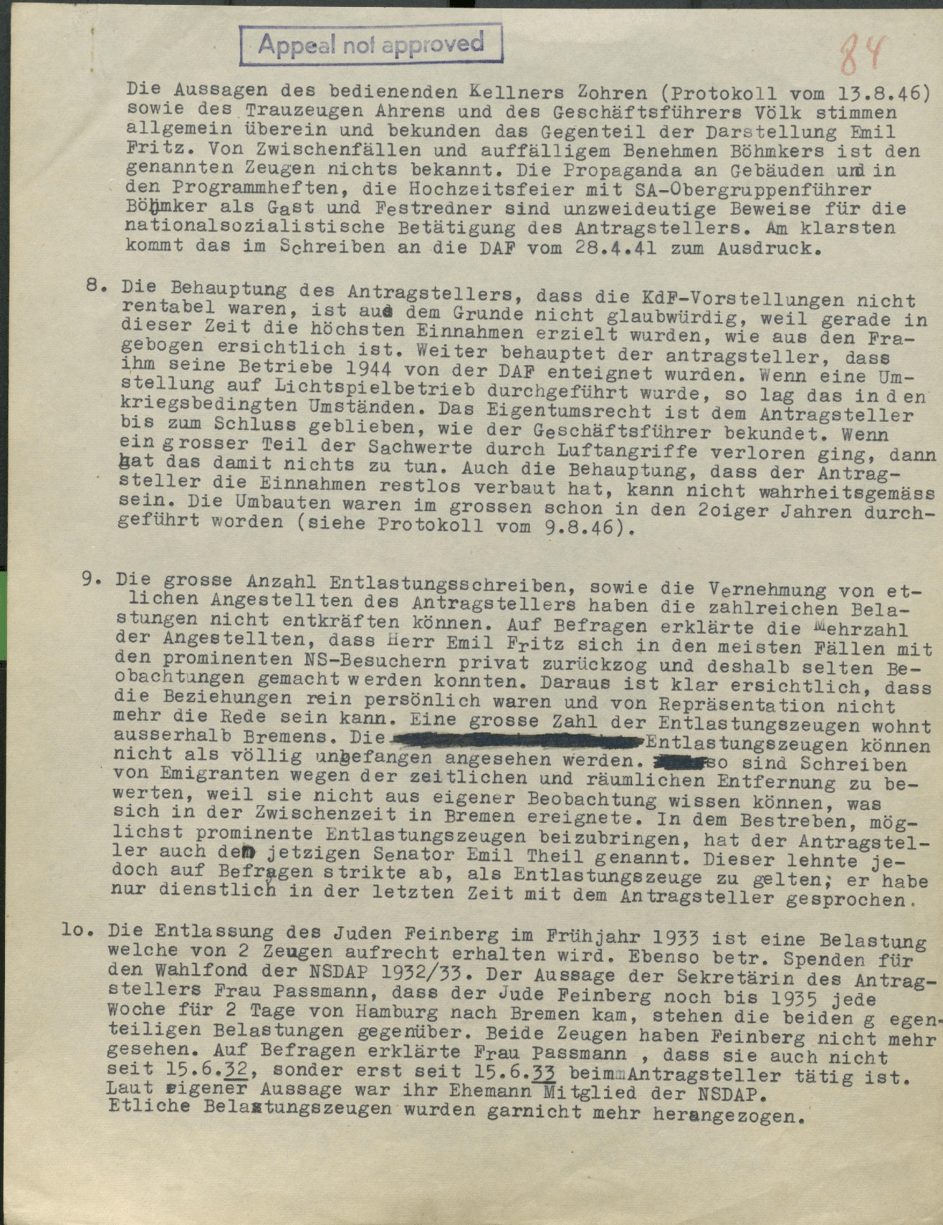
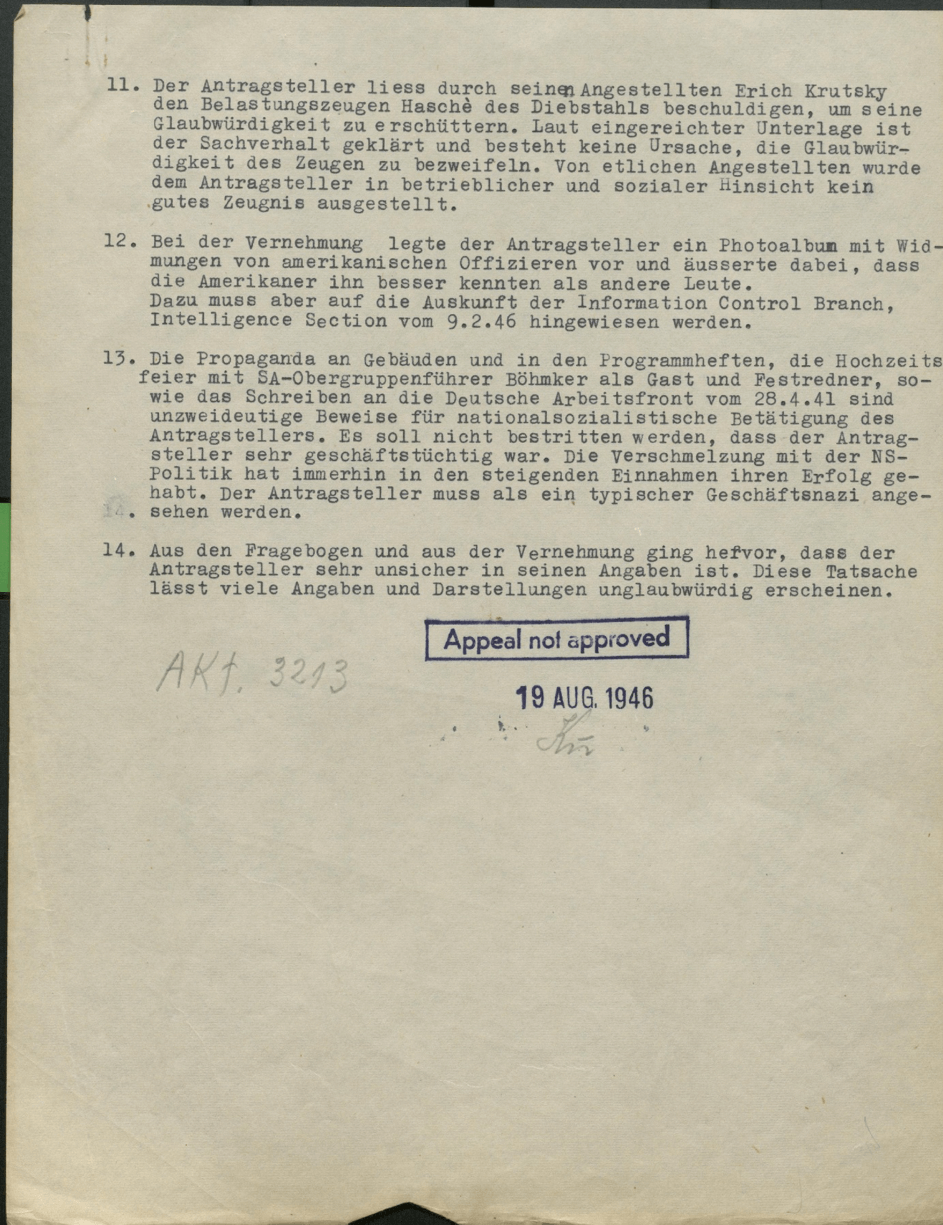
Seite 39
Eine tolldreiste Münchhausiade: Fritz als Widerstandskämpfer
Am 17. September 1946 hatte Fritz den Bescheid der amerikanischen Militärregierung erhalten, die den Spruch des Untersuchungsausschusses IV „appeal not approved“ bestätigte. Am 4. November stellte er einen Antrag auf Revision beim „review board branch“ der amerikanischen Militärregierung.[136] Aber während er in seinem Schreiben an Bürgermeister Kaisen vom 22. Januar 1946 noch zu Recht erwartet hatte, dass seine Mitgliedschaft in der NSDAP ohne weiteres als lediglich nominelle anerkannt würde, hatte sich die Lage zu seinen Ungunsten verändert. Seit dem 5. März 1946 galt in der amerikanischen Zone das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“. Es bestimmte in Artikel 13, dass nur dem NSDAP-Mitglied politische „Entlastung“ gewährt würde, der „nach dem Maß seiner Kräfte aktiv Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft geleistet und dadurch Nachteile erlitten hatte.“ Das Gesetz galt formell zwar nicht in der „Enklave“ Bremen, aber es war nur eine Frage der Zeit, wann Bremen es auch übernehmen würde.[137] Ganz im Sinne des Artikels 13 des zukünftigen Bremer Befreiungsgesetzes legte Fritz seinem „Revisions“-Antrag ein Schriftstück bei, das beweisen sollte, dass er seit 1933 aktiv „im Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft“ gestanden hätte. Eine „Bescheinigung“ genannte Erklärung vom 16. September 1946 war von einem Josef Milos aus Berlin verfasst, der im Verfahren bisher nicht in Erscheinung getreten war. Milos war von 1923 bis 1933 Geschäftsführender Direktor des „Internationalen Varietétheater- und Zirkusdirektoren-Verbandes e.V in Berlin und seit 1946 Mitglied des Ausschusses für seine Neugründung. Fritz kannte ihn schon seit 1919,[138] als Milos in den Bremer „Centralhallen“ als Artist beschäftigt war. Seitdem standen sie, „in enger Verbindung.“[139] In einem Artikel für das Programmheft des Astoria zum 25-jährigen Jubiläum 1933 schrieb er: „Durch alle Klippen: Krieg, Revolution, Inflation, Deflation und Wirtschaftskrise hat er als tatkräftiger Kapitän sein Schifflein glücklich gesteuert, hat dem zersetzenden Ansturm der Sonderbesteuerung siegreich standgehalten und kann heute nach 25jähriger Tätigkeit befriedigt auf sein Werk schauen.“[140]
[136] Dok „zu 22“. Im Briefkopf firmierte Fritz als „Varietébesitzer“.
[137] Das geschah durch Beschluss der Bürgerschaft am 9. Mai 1947.
[138] Die Jahresangabe von 1919 geht aus einer persönlichen Anmerkung des öffentlichen Klägers Lindau in seiner Begründung für den Spruch in Sachen Fritz v. 17.2.1948.
[139] Fritz: Mündliche Aussage vom 18. 12.1947 vor dem öffentlichen Kläger im Spruchkammerverfahren. Dok 8.
[140] „Astoria gestern und heute“, Dok Af 217. Dass Milos und Fritz befreundet waren, bestätigte Hasché in seiner schriftlichen Aussage vor der Spruchkammer Lindau am 17. Januar 1948.
Seite 40
Milos „bescheinigte“ Fritz, dass dieser nach der Auflösung des alten Artistenverbandes durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 Mitglied seiner „Abwehrbewegung“ geworden wäre, „vielfach wertvolle Winke zur Fortsetzung ihres Kampfes gab und diesen auch mit erheblichen Geldmitteln unterstützte, die wir zur Unterstützung unserer jüdischen Mitglieder (…) und zum Teil zu deren Fortschaffung ins neutrale Ausland benutzten.“[141] In einer „eidesstattlichen Erklärung“ ergänzte er später, seine Aussage dahingehend, dass es darum gegangen wäre, „Berufsangehörige, denen der Boden zu heiß wurde, in der Hauptsache Juden aus Berlin und anderen Städten, die Flucht ins Ausland zu ermöglichen. Zu den nächsten neutralen Grenzen, Holland und Belgien…“[142]
Fritz begann seinen vier Schreibmaschinenseiten langen Revisionsantrag vom 4. November mit einem Rundumschlag gegen die ihm „bekannt gewordenen Verleumdungen“: „Bei den mich belastenden Zeugen (handelt es sich) um Geschäftsleute, die die Entnazifizierungsbestimmungen dazu benutzen wollen, um mich als Konkurrenten loszuwerden oder aus kleinlicher Rachsucht handeln, weil ich sie früher wegen arbeitsrechtlicher Differenzen (…) entlassen musste.“ Er stellte noch einmal ausführlich dar, wie es aus seiner Sicht zu dem Hitler-Portrait am Atlantic im August 1933 gekommen war, und wie sich die Anwesenheit Böhmckers auf seiner Hochzeit 1941erklärte. Dann kam er zum Kern seines Antrags. Er wäre jetzt endlich in der Lage, „eindeutig zu beweisen, dass alle Behauptungen politischer Aktivität im Sinne des Nationalsozialismus (…) nicht auf Wahrheit beruhen.“ Er wäre „mit den folgenden Behauptungen nicht früher hervorgetreten, weil mir die Unterlagen dazu fehlten. Ich übergebe in Anlage (6) eine Bescheinigung des internationalen Varietétheater- und Zirkusdirektorenverbandes Josef Milos in Berlin, aus der sich ergibt, dass ich schon 1933 der illegalen Abwehrbewegung beigetreten bin (…) und an deren Spitze der von den Nationalsozialisten später verbrannte Herr Jules Marx stand. Ich habe dieser Abwehrbewegung bis 1945 aktiv angehört.“ Ich hoffe, schrieb er zusammenfassend, „dass ich nunmehr den eindeutigen Beweis für meine antifaschistische Haltung gebracht habe.
[141] „Bescheinigung“. Schreiben von Josef Milos vom 16.9.1946, ausgestellt in Berlin-Neukölln. E-Akte Fritz, Nr.148.
[142] Abschrift einer Eidesstattlichen Erklärung vom 28. 12.1946, ausgestellt in Berlin-Neukölln. Dok-Nummerierung unleserlich.
Seite 41
Was kann das Geschrei meiner Konkurrenz und der früheren Geschäftsführer, die ich wegen Unzuverlässigkeit entlassen musste, gegenüber der mir von Herrn Präsidenten Milos bezeugten Tatsachen bedeuten, dass ich in der illegalen Abwehrbewegung des Artistenverbandes mitgewirkt habe.“ Sein Schreiben endet mit dem Aufruf des Zeugen Milos: „Sollten (…) noch Zweifel über meine einwandfreie antifaschistische Haltung obwalten, so bitte ich den Präsidenten Milos, der sich in den nächsten Wochen vorübergehend in Bremen aufhalten wird, persönlich zu vernehmen.“[143] In seiner Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger am 18. Dezember 1947 gibt Fritz eine nähere Schilderung seiner Tätigkeit im „Widerstand“: „Wir verabredeten als Stichwort „Akropolis“ und beschlossen, dass alle die jüdischen Artisten und Theaterdirektoren und auch andere Juden, die sich unter dem eben genannten Stichwort bei mir meldeten, von mir betreut und über die holländisch-belgische Grenze in Sicherheit gebracht wurden. Sie sollten vor dem Zugriff der Gestapo gerettet werden und wurden von mir mit Geldmitteln, Lebensmitteln und mit Anweisungen über den bequemsten und ungefährlichsten Grenzübergang versehen. Ich habe im Laufe der Jahre trotz meiner nominellen Parteizugehörigkeit dieser Menschenpflicht in vielen Fällen Genüge getan.“[144] Am 23. Dezember 1947 fasste er noch einmal zusammen: „Ich bin immer ein entschiedener Gegner des Regimes Hitlers gewesen, habe meinen Kampf dagegen aktiv geführt, indem ich unterdrückten Juden meine Hilfe angedeihen ließ und mich dadurch selbst den schwersten Gefahren ausgesetzt. Wäre mein aktives Eintreten für die Juden damals den Parteigrößen bekannt geworden, wäre ich bestimmt im Konzentrationslager gelandet und daraus nicht lebend wieder zurückgekehrt.“[145]
Es bedarf keines besonderen Scharfsinns, um bei näherer Betrachtung der Dokumente zu erkennen, dass die Widerstands-Geschichte frei erfunden war. Schon in der Frage, wann ihre gemeinsame Tätigkeit in der Illegalität begonnen hatte, widersprachen sich die Aussagen. Während Fritz behauptete, schon 1933 der „Abwehrbewegung“ beigetreten zu sein, erklärte Milos in seiner eidesstattlichen Erklärung vom Dezember 1946, dass er Fritz im Herbst 1937 zum ersten Mal aufgesucht und „in vorsichtig geführter Unterhaltung“ den Eindruck gewonnen hätte, dass der „kein Nationalsozialist sei.“ Erst ein Jahr später hätte er Fritz bei einem zweiten Besuch in Bremen in die Aktionen der „illegalen Bewegung eingeweiht“. [146]
[143] Das wird am 29. November 1947 im Spruchkammerverfahren vor dem öffentlichen Kläger Lindau geschehen. Dok „zu 10“.
[144] Aussage in der Vernehmung vor dem öffentlichen Kläger der Spruchkammer Bremen am 10. Dezember 1947. Dok 8 und in der Vernehmung vom 18. Dezember 1947.
[145] Dok „zu Nr.10“.
[146] Eidesstattsliche Erklärung von Milos am 28.12.1946, Dok „zu 10“.
Seite 42
Wieso tauchte Josef Milos als Zeuge nicht gleich im ersten Vorstellungsverfahren auf, das Fritz am 22. Dezember 1945 beantragt hatte? Dieser Frage sei hier nachgegangen. Zur Vorbereitung des Verfahrens hatte Fritz schon am 18. Und 29. Dezember Briefe an die Varieté-Verbands-Präsidenten O’Leary in Hamburg und Schwartz in Berlin-Ost geschrieben, in denen er sie um politische Entlastung bat. Die Antworten waren freundlich unverbindlich, mit viel Lob für seine Direktoren-Tätigkeit, ohne aber zur politischen Dimension des Verfahrens einen Beitrag zu leisten. Wieso hatte Fritz nicht auch an Milos geschrieben, der wieder in Berlin-West am Wiederaufbau des Internationalen Varietétheater- und Circus-Direktoren Verbands tätig war, dessen Geschäftsführender Direktor er seit 1923 gewesen war? Wenn es stimmte, was Milos in einer Zeugenaussage angab, dass er mit Fritz „bis 1945 eine Reihe von Besprechungen“ hatte,[147] warum haben die beiden Herren sich dann nicht, was noch näher gelegen hätte, einfach in Berlin oder Bremen getroffen?
Derartige Fragen, die zur Klärung von zahlreichen Widersprüchen in den Aussagen der Protagonisten hätten beitragen können, wurden in den Spruchkammerverfahren nicht gestellt. So konnte Milos am 29. November 1947 im Spruchkammerverfahren vor dem öffentlichen Kläger Lindau unwidersprochen folgende Aussage machen: „Ich bin seit Januar 1947 der Leiter des von der amerikanischen Militärregierung eingesetzten Sachbeirats beim Hauptamt für Kunst des Magistrats der Stadt Berlin. Auf einer Dienstreise befindlich, habe ich durch Zufall von dem gegen Herrn Emil Fritz befindlichen Entnazifizierungsverfahren Kenntnis erhalten…“ Schon die Datierung ist falsch, denn seine erste Aussage hatte er ja, wie dargestellt, bereits am 28. September 1946 gemacht. Dass er seinen langjährigen Kampfgefährten, mit dem er angeblich bis 1945 in Kontakt gestanden hatte, nicht besuchte, sondern von dritter Seite erfahren haben will, dass er in Schwierigkeiten steckte, ist ebenfalls unglaubwürdig. Auch die Aussage, dass er sich daraufhin dem zuständigen Kläger – dessen Namen er nicht nennt – „zur Verfügung gestellt“ hätte, entspricht nicht der Wahrheit. Seine erste Aussage war schriftlich und in Berlin verfasst. Sie lag seit dem 28. September 1946 im Büro von Toni Paßmann. Da hatte Milos noch keinen Fuß auf Bremer Boden gesetzt. Wir haben diese abenteuerliche Aussage deshalb “seziert“, weil sie ein Spiegelbild der zunehmenden Unverfrorenheit der Protagonisten war, die sich – je länger das Verfahren dauerte, umso mehr – darauf verlassen konnten, dass ihnen keine unangenehmen Fragen gestellt wurden.
[147] Bescheinigung von Josef Milos. Dok 146, Anlage 6.
Seite 43
Wenn Fritz in seinem Revisions-Antrag gegen den Entlassungsbescheid der Militärregierung am 4. November 1946 angab, dass er mit dem Zeugen Milos „nicht früher hervorgetreten (wäre), weil mir die Unterlagen dazu fehlten“, dann lag das an ihm. Er hätte einen Aufschub der Verhandlung beantragen können, wie er das im Mai 1946 vor dem Untersuchungsausschuss IV getan hatte. Da hatten ihm „zwei wertvolle Zeugen“ gefehlt, von denen er „täglich Nachricht erwartete.“ Es handelte sich um zwei jüdische Artisten, die emigrieren mussten und von denen er noch nicht einmal wusste, ob sie noch lebten.
Vier weitere Entlastungsschreiben vom 4. November, die Fritz
gemeinsam mit seinem Revisions-Antrag eingereicht hatte, waren nach dem gleichen Schema aufgebaut und erkennbar auf der gleichen Maschine geschrieben worden. Auch die eidessstattliche Erklärung von Milos vom 28. Dezember, laut Briefkopf in Berlin verfasst, wurde als Kopie eingereicht. Sie war auf einem Vordruck des Internationalen Varietétheater-Verbandes aus den zwanziger oder frühen dreißiger Jahren geschrieben, erkennbar mit der Schreibmaschine von Toni Paßmann. Es fragt sich, wie Milos‘ Unterschrift auf diese Kopie gelangt war.[148] Hatte Milos den Bremern einen leeren Vordruck geschickt? War die Wohnung in der Goebenstraße zur Schreibwerkstatt der Entnazifizierung geworden? Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen. Im letzten kritischen „D und E Report“ in Sachen Fritz‘ Entnazifizierung wird er ausdrücklich geäußert.
Die einzelnen Teile der Geschichte passen nicht zueinander, aber erst, wenn wir ihr Fundament anschauen, bricht sie zusammen. Milos versicherte eidesstattlich, dass er nach der Zwangs-Auflösung des „Internationalen Varietétheater- und Zirkusdirektoren-Verbandes e.V.“,„mit früheren Mitgliedern, die ihm vertrauenswürdig erschienen, Verbindung auf(genommen hätte), um sie für illegale Arbeit (…) zu gewinnen.“ „Ein großer Prozentsatz war mosaischen Glaubens. Viele, wie der Präsident Jules Marx, Inhaber der „Scala“ in Berlin, die Vorstandsmitglieder Friediger, München, Raphael und S. Flatow, Berlin u.a.m. wurden jahrelang gefangen gehalten und später in Auschwitz und Theresienstadt vergast.“ Jules Marx hätte „an der Spitze“ ihrer „illegalen Abwehrbewegung“ gestanden.[149] Marx, Eigentümer mehrerer Varietés, bis 1933 Direktor der weltberühmten
[148] Das Wort „Abschrift“ wurde in einem späteren Untersuchungsverfahren von einem Ausschussmitglied rot unterstrichen.
[149] In der „Bescheinigung“ vom 16.9.1946.
Seite 44
Scala in Berlin, war Präsident des „Internationalen Varietétheater und Zirkusdirektoren-Verbandes“, dessen Geschäftsführer Milos von 1923 bis 1933 war. Er war schon 1933 nach Paris geflohen. Seine Varietés wurden, weil er Jude war, von den Nazis enteignet, um sie „Nichtjuden“ zu übergeben. Es reichte den Nazis nicht, ihn nur enteignet zu haben. Man erlegte dem Geflohenen, da er nicht um „Erlaubnis“ für seine Ausreise ersucht hatte, eine „Reichsfluchtsteuer“ in Höhe von 65.025 RM auf. Und auch das genügte ihnen noch nicht. Da er die Steuern nicht bezahlt hatte, wurde er in Deutschland seitdem „steuersteckbrieflich“ gesucht. In Paris hatte er zunächst ein Varieté („Empire“) betrieben, gründete dann 1937 mit einem Partner in Zürich eine literarische Agentur, lebte aber weiter in Paris. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Franzosen als „feindlicher Ausländer“ verhaftet und im Sammellager Gurs interniert. „Nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht lieferte man Marx Anfang 1943 der Gestapo aus, die ihn im Februar desselben Jahres (…) in das KZ Sachsenhausen überstellte. Dort starb Jules Marx 15 Monate darauf.“[150] Mit diesem Jules Marx will Milos im Herbst 1937 (sic!) in Berlin Rücksprache darüber gehalten haben, ob man versuchen sollte, den Bremer Varieté-Besitzer Emil Fritz für die „illegale Abwehrarbeit“ zu gewinnen. In die geheimen Gespräche wäre aber nicht nur Jules Marx eingebunden gewesen, sondern auch die folgenden „Leiter und Inhaber der Varietétheater, Kabaretts und Zirkusse“ Bartuscheck, Ding Braunschweig, Dr. Raphael, Sigmund Flatow und Markus Friediger, die alle Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik wurden. An der Spitze der „Abwehrbewegung“, schrieb Fritz, stand „der von den Nationalsozialisten später verbrannte Herr Jules Marx.“ Im KZ Sachsenhausen fanden keine Vergasungen statt. Milos und Fritz hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, herauszufinden, wo, wie und wann der angeblich so Verehrte ums Leben gekommen war. [151]
In dieser Geschichte wurden die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft missbraucht als angebliche Zeugen einer Widerstandsbewegung, die es nie gab und deren einziges Ziel es war, Emil Fritz als Mitglied der NSDAP politisch zu entlasten. Von den „sehr vielen Varietétheater-Inhabern und sehr vielen Kunstkräften der Artistik“, die Mitglieder der „Abwehrbewegung“ gewesen sein sollen, trat im ganzen Verfahren nicht einer in den Zeugenstand. Den zahlreichen Juden, denen Fritz zum Grenzübertritt nach Belgien verholfen haben soll, gibt Milos nur einmal Namen.
Scala in Berlin, war Präsident des „Internationalen Varietétheater und Zirkusdirektoren-Verbandes“, dessen Geschäftsführer Milos von 1923 bis 1933 war. Er war schon 1933 nach Paris geflohen. Seine Varietés wurden, weil er Jude war, von den Nazis enteignet, um sie „Nichtjuden“ zu übergeben. Es reichte den Nazis nicht, ihn nur enteignet zu haben. Man erlegte dem Geflohenen, da er nicht um „Erlaubnis“ für seine Ausreise ersucht hatte, eine „Reichsfluchtsteuer“ in Höhe von 65.025 RM auf. Und auch das genügte ihnen noch nicht. Da er die Steuern nicht bezahlt hatte, wurde er in Deutschland seitdem „steuersteckbrieflich“ gesucht. In Paris hatte er zunächst ein Varieté („Empire“) betrieben, gründete dann 1937 mit einem Partner in Zürich eine literarische Agentur, lebte aber weiter in Paris. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde er von den Franzosen als „feindlicher Ausländer“ verhaftet und im Sammellager Gurs interniert. „Nach der Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht lieferte man Marx Anfang 1943 der Gestapo aus, die ihn im Februar desselben Jahres (…) in das KZ Sachsenhausen überstellte. Dort starb Jules Marx 15 Monate darauf.“[150] Mit diesem Jules Marx will Milos im Herbst 1937 (sic!) in Berlin Rücksprache darüber gehalten haben, ob man versuchen sollte, den Bremer Varieté-Besitzer Emil Fritz für die „illegale Abwehrarbeit“ zu gewinnen. In die geheimen Gespräche wäre aber nicht nur Jules Marx eingebunden gewesen, sondern auch die folgenden „Leiter und Inhaber der Varietétheater, Kabaretts und Zirkusse“ Bartuscheck, Ding Braunschweig, Dr. Raphael, Sigmund Flatow und Markus Friediger, die alle Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik wurden. An der Spitze der „Abwehrbewegung“, schrieb Fritz, stand „der von den Nationalsozialisten später verbrannte Herr Jules Marx.“ Im KZ Sachsenhausen fanden keine Vergasungen statt. Milos und Fritz hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, herauszufinden, wo, wie und wann der angeblich so Verehrte ums Leben gekommen war. [151]
Hier wurden die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft als angebliche Zeugen einer Widerstandsbewegung, die es nie gab, missbraucht mit dem einzigen Ziel, Emil Fritz als Mitglied der NSIn dieser Lügengeschichte wurden die Opfer zu angeblichen Zeugen in einer erlogenen Widerstandgeschichte missbrauchte, die nur dem Zweck diente, Fritz als Mitglied der NSDAP politisch zu entlasten. Von den „sehr vielen Varietétheater-Inhabern und sehr vielen Kunstkräften der Artistik“, die Mitglieder der „Abwehrbewegung“ gewesen sein sollen, trat im ganzen Verfahren nicht einer in den Zeugenstand. Den zahlreichen Juden, denen Fritz zum Grenzübertritt nach Belgien verholfen haben soll, gibt Milos nur einmal Namen.
[150] Die Informationen sind Wikipedia entnommen, Stichwort „Jules Marx“ vom 9.03.2021. Dort ist die steuersteckbriefliche Fahndung
für 1935 nachgewiesen.
[151] Milos behauptete, die von ihm genannten Mitglieder der „Abwehrbewegung“ wären in Auschwitz oder Theresienstadt vergast worden. Theresienstadt war kein Vernichtungslager. Aus der „Eidesstattlichen Erklärung, Berlin -Neukölln am 28. Dezember 1946“ von Josef Milos. Es ist eine „Abschrift“, wie es im Titel heißt. Der Text ist erkennbar auf der Schreibmaschine von Toni Paßmann geschrieben worden. Die Kopfzeile heißt: Internationaler Varietétheater- und ZIrkus-Direktoren-Verband e.V. Berlin“ Der Briefkopf ist – mit Schreibmaschine ergänzt mit dem Wort „Gründungsausschuss“ – aus der Zeit vor Auflösung des Verbandes 1934. 1946 gab es den Verband noch nicht. Milos behauptete, die von ihm genannten Mitglieder der „Abwehrbewegung“ wären in Auschwitz oder Theresienstadt vergast worden. Theresienstadt war kein Vernichtungslager.
Seite 45
Aber die beiden genannten Pasch und Shelden erscheinen im Laufe des Verfahrens genauso wenig, wie auch nur einer oder eine der angeblich in den Jahren 1933 bis 1945 Geretteten oder einer ihrer Verwandten.
Die folgende Geschichte von Milos wollen wir nicht auslassen, weil sie ein Beispiel dafür ist, wie die Absicht der Erzähler, Erdachtes durch Einzelheiten glaubwürdiger zu machen, auch in ihr Gegenteil umschlagen konnte: „Bei meinem letzten Aufenthalt in Bremen, es mag 1939 gewesen sein, hatte der Unterzeichnete auch persönlich folgendes für die Einstellung von Fritz bezeichnendes Erlebnis: Kurz vor Lokalschluss des „Astoria“ hatte er eine Rotte von 8 teils uniformierten SS-Männern, die die Vorstellung störten, wegen Randalierens Lokalverbot angedroht. Als ich kurz darauf das Lokal verließ, um mich in mein Hotel zu begeben, fiel die Rotte, die mich wahrscheinlich in Gesellschaft von Fritz gesehen hatte, über mich her. Unglücklicherweise zerschlug der erste treffende Schlag meine Brille, wodurch ich in der Abwehr stark behindert wurde. Fritz, der mich begleitet hatte, sprang mir sofort bei und hieb ohne weiteres mit schweren Schlägen mit auf die Burschen ein, die dann, soweit sie nicht am Boden lagen, flüchteten. Es gäbe noch allerlei über die Haltung und Zuverlässigkeit des Herrn Fritz zu sagen.“ [152]
Wieso fielen die SS-Männer nicht über Fritz her, der doch der Grund für ihre Wut war? Und wieso war es wichtig, dass Milos die Brille zerschlagen und er dadurch verteidigungsunfähig geworden war? Offensichtlich deshalb, damit Fritz als sein mutiger Retter auftreten konnte. Warum mussten es uniformierte SS-Männer sein? Offensichtlich, damit die Schlägerei eine politische Dimension erhielt. Und vor allem: Welche Folgen muss das für das Astoria gehabt haben? Das Deutsche Reich befand sich ja nicht mehr in der „Kampfzeit“, sondern im siebenten Jahr einer gefestigten Terrorherrschaft. Warum mussten es gleich acht SS-Männer sein? Immerhin war Fritz zu diesem Zeitpunkt schon 62 Jahre alt. Offensichtlich, weil damit bewiesen werden sollte, dass er als Mann im fortgeschrittenen Alter bereit war, sein Leben einzusetzen. Fritz‘ Darstellung des Vorfalls ist weniger phantasievoll, aber blutiger: „Mein Eintreten für den Präsidenten Milos hat sogar noch im Jahre 1938 dazu geführt, dass ich von nationalsozialistischen Aktivisten auf offener Straße angefallen und verprügelt worden bin. Ich habe mich schützend vor den Präsidenten Milos gestellt, der blutend am Boden lag und unter Lebensgefahr von mir in Hillmanns Hotel gerettet wurde.“[153] Auch für diesen Vorfall gab es keine Zeugen.
[152] Aus der Eidesstattlichen Erklärung vom 28. Dezember 1946. A.a.O.
[153] Schreiben an die Militärregierung vom 4. November 1946. A.a.O.
Seite 46
Sogar Fritz‘ Parteimitgliedschaft, die er und andere Zeugen bis dahin damit begründet hatten, dass man ihn sonst in den wirtschaftlichen Ruin getrieben hätte, erhielt jetzt eine völlig andere Bedeutung: „Zu dieser illegalen Abwehrarbeit wäre ich niemals in der Lage gewesen, wenn ich mich nicht rein äußerlich zu der NSDAP und ihren führenden Persönlichkeiten (sic!) in eine Lage gebracht hätte, nach welcher man mir zur Zeit des nationalsozialistischen Regimes die illegale Tätigkeit nicht zutraute.“[154]
Von Stund‘ an waren diese Geschichten Bestand in Fritz‘ politischer Rehabilitation. Entlastungszeugen ergänzten frühere Aussagen, in denen kein Wort über Fritz‘ Widerstandstätigkeit stand, dahingehend, wobei sich alle auf die Aussagen von Milos beriefen. Mit der Widerstandsgeschichte stand jetzt eine Phalanx von Personen aus der artistischen Welt hinter Fritz: Künstler-Agenturen, Lieferanten, Kellner. Die Hoffnungen vieler Artisten nicht nur aus Deutschland ruhten auf einem neuen Astoria in Bremen, ungeachtet und vielleicht auch in Unkenntnis der Probleme, die Fritz aus politischen Gründen als Varieté-Direktor hatte.
Dem Revisionsantrag vom 4. November 1946 legte Fritz vier „eidesstattliche Erklärungen“[155] bei, ausgestellt von fünf Entlastungszeugen. Sie waren optisch nach dem gleichen Schema aufgebaut und erkennbar auf der gleichen Maschine geschrieben. Verfasser waren ein G. Becker, Inhaber einer Firma, die Dekorationen in den E.-F.-Betrieben durchgeführt hatte, die Oberkellner F. Seegers und L. Eickhoff, die zwanzig Jahre bei Fritz gearbeitet hatten, der Kaufmann W. Bormann und Toni Paßmann, die ein zweieinhalb Seiten langes Schreiben beigelegt hatte. Seegers berichtete von einem Vorfall, als Bürgermeister Böhmcker „sich im betrunkenen Zustand in der Loge so aufführte, dass damit die ganze Aufführung gestört wurde.“ Er hatte Fritz zu Hilfe und es kam zu einer „sehr erregten Unterredung (…) die wie ich jetzt gehört habe, mit einem Schlagwechsel endete. Ich weiß, dass Herr Fritz damals zu mir gesagt hat, ich habe den Schweinehund hinausbefördert.“ Andere Zeugen für den Vorfall nannte er nicht. Sein Kollege Eickhoff, der nicht dabei war, unterschrieb die Geschichte aber praktischerweise gleich mit. Die Erklärung von Toni Passmann[156] erhielt noch eine phantasievolle Geschichte, in der es, nüchtern
[154] Schreiben vom 4. November, a.a.O.
[155] Dokumente 143 bis 147.
[156] Dok 144.
Seite 47
erzählt, um ein angebliches Schreiben von NSDAP-Kreisleiter Schümann aus den Jahren „1942 oder 1943“ (!) ging, in dem er Fritz politische Unzuverlässigkeit vorwarf. Die Zeugin konnte es aber nicht vorlegen, da es mit ihren „übrigen Papieren verbrannt“ war.“ [157] In dem folgenden Teil ihrer eidesstattlichen Erklärung wagte Toni Paßmann eine Aussage, deren fehlender Wahrheitsgehalt schon damals ohne weiteres hätte nachgewiesen werden können: „Ich habe keinerlei wirtschaftliche Interessen an dem Ausgang des Vorstellungsverfahrens von Herrn Fritz. Ich habe inzwischen eine eigene Agentur eröffnet und werde, auch wenn das von Herrn Fritz geführte Vorstellungsverfahren zu seiner Rehabilitation führt, in keinem der von ihm zu eröffnenden Betriebe meine bisherige Stellung wieder aufnehmen.“ [158] In Wahrheit blieb sie die rechte Hand von Fritz bis zu dessen Tod 1954,[159] auch wenn die Goebenstraße 16 in den späten Vierzigern als Künstler-Agentur firmierte. Der Verdacht liegt nahe, dass die Offensive, zu der Fritz in Sachen seiner Rehabilitation jetzt übergegangen war, in ihrer Wohnung auf den Weg gebracht wurde.
[157] Ihre Geschichte: Fritz hätte auf Initiative „der Ärzteschaft“ eine Auszeichnung dafür erhalten sollen, dass er Vorstellungen „für die Verwundeten, die sich in der Stadt aufhielten“, veranstaltet hatte. NSDAP-Kreisleiter Schünemann hätte in dieser Sache einen Brief an Fritz (!) geschickt, in dem er erklärte, dass die Auszeichnung für ihn abgelehnt werden müsste und dass sie erst „infrage komme, wenn er seine Einstellung zur Partei grundsätzlich ändere.“ In den besagten Jahren war Fritz schon seit fünf, bzw. sechs Jahren Parteimitglied. Es war ein Jahr, nachdem ihn Hago-Leiter von Hagel öffentlich an seinem 60. Geburtstag geehrt hatte.
[158] Dok 145.
[159] Vgl. Monika Felsing (Hrsg.), Unser Astoria. A.a.O., S.108.
Seite 48
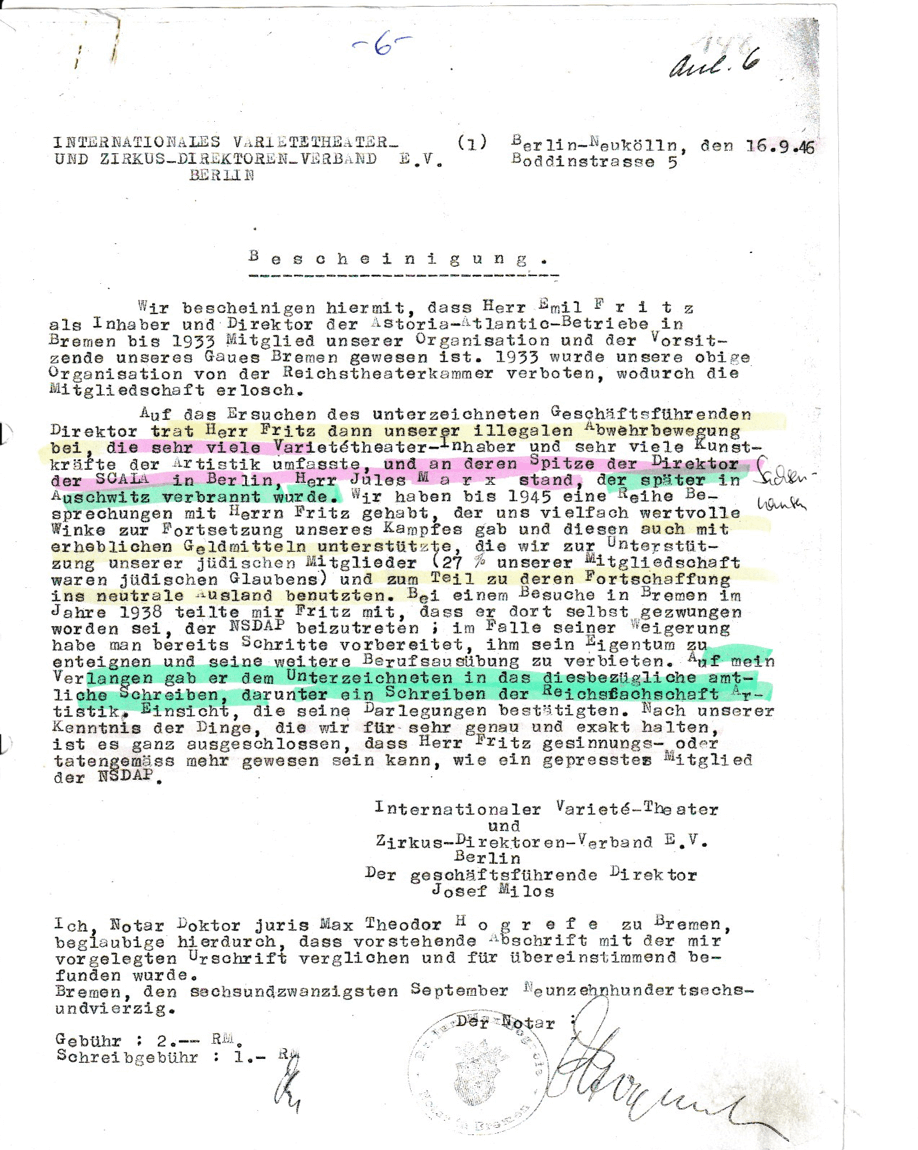
Seite 49
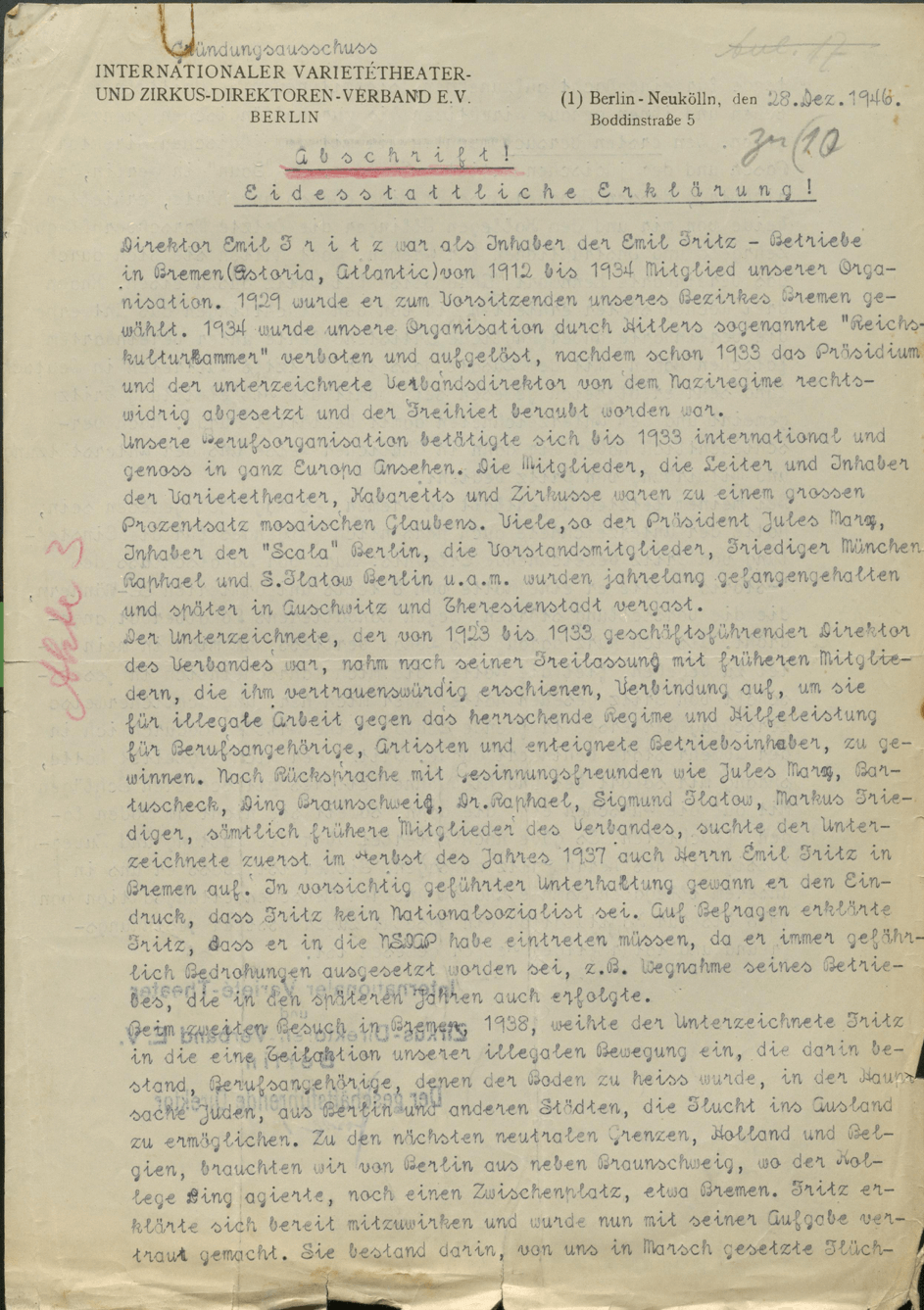
Seite 50
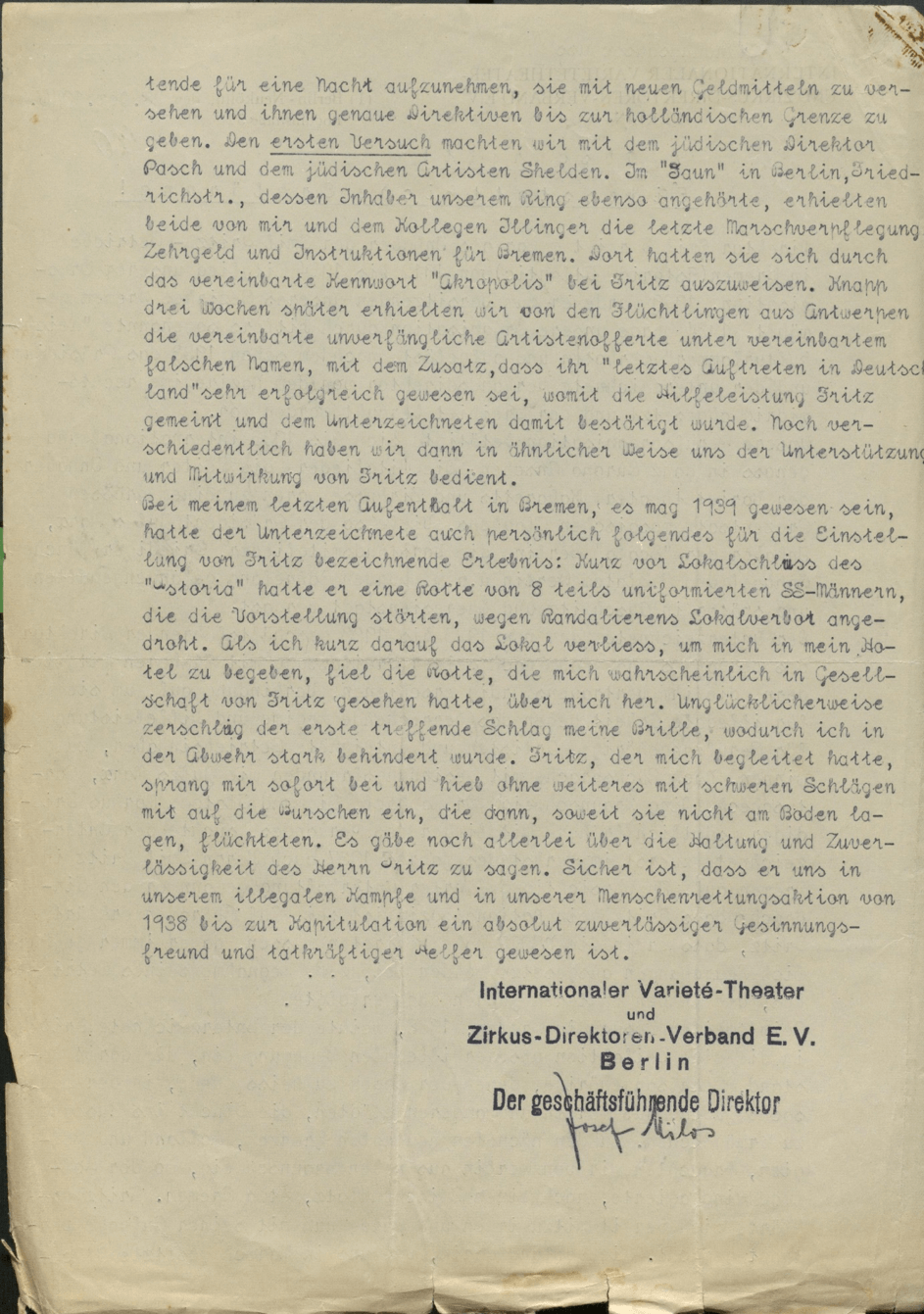
Seite 51
Doppelstrategie: Entnazifizierung in der britischen Zone
Die Briten hatten die Grundsätze des amerikanischen Entnazifizierungssystem zwar grundsätzlich übernommen, handhabten sie aber wesentlich weniger restriktiv. So hatte es sich bald bei den Betroffenen in der amerikanischen Zone herumgesprochen, dass es in der britischen Zone gute Chancen gab, schnell entnazifiziert zu werden.[160] Die Briten legten „von Beginn an größeren Wert auf die Wiederherstellung der administrativen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Besatzungszone.“[161] Manchem Betroffenen gelang es, durch einen Wechsel von Wohnort oder/und Arbeitsplatz die Entnazifizierung in der amerikanischen Zone zu vermeiden.[162] Fritz hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg eine Jagd in der Gemeinde Sottrum / Kreis Rotenburg gepachtet und 1919 ein Wochenend- Jagdhaus in Sottrum auf dem Grundstück Fährhof 5 gebaut,[163] das Ausgangspunkt für seine regelmäßigen Treibjagden war. Beides lag in der britischen Zone. In einer späteren Erklärung gab er sogar an, „von der eigenen Landwirtschaft“ gelebt zu haben, nachdem ihm Ende 1945 der Zugriff auf sein Vermögen verwehrt worden war.[164] Er fuhr nun zweigleisig. Seit der Teil-Zerstörung seiner Villa in der Parkallee 109 im Herbst 1944[165] war sein Jagdhaus in Sottrum offizieller Wohnsitz der Familie mit Frau und vier Kindern.[166]
[160] Ein interner Intelligence Summary“ der britischen Militärregierung stellte im November 1947 fest, dass in manchen Fällen, wo Betroffene sich in der englischen Zone entnazifizieren ließen und dem Bremer Befreiungssenator ihre politische Entlastung vorlegten, diese ohne die notwendigen Beweise erteilt worden waren: „In nearly all these cases, it has been found that a clearance has been given without the full evidence being presented.“ Anna-Maria Pedron, Amerikaner vor Ort. Besatzer und Besetzte in der Enklave Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bremen 2010 (Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen, hrsg. von Jörn Brinkhus, Band 70), S. 230- 233; hier S.232.
[161] „Zwar wurde (…) das amerikanische Entnazifizierungssystem, einschließlich des ausführlichen Fragebogens übernommen, aber die Auswertung verlief nach weniger restriktiven Kriterien.“ Pedron, a.a.O., S.231.
[162] Erfolgreich war zum Beispiel Fritz‘ Eiswettgenosse Georg Borttscheller, der spätere Hafensenator und langjährige Präsident der Eiswette. Ihm gelang es, obwohl er seit 1926 in Bremen gewohnt und gearbeitet hatte, sich in Bielefeld entnazifizieren lassen. Dort nahm man ihm, dem Chefredakteur der Weser-Zeitung, Verfasser vieler (pronazistischen) Artikel ab, dass er „er deren Titel und Daten der Fülle wegen (!)“ nicht mehr angeben könne. Vgl. die ausführliche Darstellung auf der Website des Verfassers, Kapitel 8: Kalter Krieg und Wirtschaftswunder. Die Ära Borttscheller, www.diegeschichtederbremereiswette.de, Kapitel 8: Kalter Krieg und Wirtschaftswunder. Die Ära Borttscheller 1951 – 1967.
[163] Das geht aus einem Brief hervor, den er am 12. Oktober 1919 an den Gemeindevorsteher von Sottrum geschrieben hatte. Privatarchiv Arndt Frommann
[164] Spruchkammer Bremen. Der öffentliche Kläger. Fragen an den Betroffenen. Dok 7 vom 26. Nov. 1947.
[165] Die Villa in der Parkallee 109 ist am gleichen Tag wie das Astoria am 6. Oktober 1944 von Bomben getroffen worden. Ob es wirklich ein Totalschaden war, wie Fritz behauptete, sei dahingestellt. Immerhin hatten die Amerikaner noch am 2.12. 1947 dort Mobiliar im Wert von 23.000 RM festgestellt, darunter Gemälde im Wert von 4000 RM. Die Adresse für die Auflisten des Privatvermögens war nicht das Jadhaus, sondern die Parkallee 109. Wie dem auch sei, die Prachtvilla ist nicht wiederhergestellt worden. Als das Grundstück im April 1954 verkauft werden sollte, wurde es von einem Kaufinteressenten als „Ruinengrundstück“ bezeichnet. Andererseits hieß es in einer Voranfrage für den Kauf im Juni 1955: „Wiederaufbau des Vorderhauses unproblematisch.“ (StAB 4,125/1-8151; Parkallee, 2. Band). In den Bauakten finden sich nur Baumaßnahmen, die das Gartenhaus im hinteren Teil des Grundstücks betreffen. Ursprünglich Garage, wurde es 1927 zu einem kleinen Wohnhaus mit 56 qm Fläche umgebaut. Es war durch eine Brandbombe nur leicht beschädigt und wurde von Fritz in Eigenregie wieder hergerichtet. Schon am 11. Januar 1945 (!) hatte er für das beschädigte Haus eine Baugenehmigung zur Einrichtung einer (weiteren?) Wohnung mit Büro beantragt und die Arbeiten am 6. März 1945 abgeschlossen. Möglicherweise hielt er sich in den Jahren 1945 bis 1949 dort auf, wenn er in der Woche seine Aufbau-Pläne in der Stadt weiterverfolgte. Von 1945 bis 1952 wohnte hier Erich K., Hausmeister und Dekorateur, den Fritz als Hauptbelastungszeugen gegen Hasché aufgestellt hatte. Das Gartenhaus steht heute noch auf dem Grundstück. Im ersten Einwohner-Adressbuch Bremens nach dem Krieg 1950 ist Fritz wieder in der Parkallee 109 gemeldet. An der Stelle der Villa steht heute ein Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen. (In den Jahren 1943 bis 1947 gab es kein Bremer Adressbuch; 1947 erschien nur ein Branchenbuch; 1949 kam weder das eine noch das andere heraus.)
[166] In einem Schreiben seines Rechtsanwalts Wentzien an den Öffentlichen Hauptkläger Buchenau beim Befreiungssenator nannte er sogar 1940 als Einzugsdatum. Schreiben vom 2. Juli 1947. Dok 52.
Seite 52
Hier beantragte er am 30. August 1946 seine Entnazifizierung – noch vor Abschuss seines Entnazifizierungs-Verfahrens in Bremen.
Die Geschichte des gescheiterten Entnazifizierungsversuchs in Sottrum ist ein Kapitel für sich; schon ihr Anfang ist eine Erzählung wert. Sein Rechtsanwalt Wentzien hat sie, in juristischer Kürze und Nüchternheit, erzählt. Zwei britische Offiziere hätten demnach einen Deal mit Fritz geschlossen. Gehen wir einfach davon aus, dass der Dienst in der britischen Besatzungsarmee im kargen Norddeutschland sowohl für die einfachen Soldaten wie für ihre Vorgesetzten auf Dauer ausgesprochen langweilig gewesen sein muss. Wentzien berichtete, dass die Majors Allen Camp, Commandant in Wandsbek und Pik den Fritz dazu „veranlasst“ hätten, seine Entnazifizierung in der britischen Zone zu beantragen, was Fritz am 30. August tat. Denn auch in der britischen Zone war seine Entnazifizierung wegen der NSDAP-Mitgliedschaft unumgänglich für seine weitere berufliche Tätigkeit. Im Gegenzug hätte er dafür die „Truppenbetreuung“ der britischen Besatzungsarmee in Norddeutschland übernehmen sollen.[167] Wie die beiden Offiziere von Fritz‘ ruhmreicher Tätigkeit als Astoria-Direktor erfahren hatten, geht aus den Akten nicht hervor. Wahrscheinlich war er es, der die Initiative ergriffen hatte. Er wohnte ja im Einzugsgebiet der britischen Truppen und hatte keine Scheu vor den Machthabern. ist leicht vorstellbar. Er wohnte ja in ihrem Einzugsgebiet und hatte keine Scheu vor den Machthabern. Offensichtlich hatte er bald „wichtige geschäftliche Vorverträge in der britischen Zone abgeschlossen.“ [168]
[167] Das berichtet Wentzien in einem Brief vom 27 August 1947 an den Leiter der Denacification Division, Joseph Napoli. Darin heißt es, dass Fritz den Antrag „auf Veranlassung des britischen Maj. Allen Camp.Commandant in Wandsbeck und des brit. Maj.Pik zwecks Beauftragung des Antragstellers mit der Durchführung englischer Truppenbetreuung“ gestellt hat. Dok zu 12
[168] Das geht aus einem Brief des öffentlichen Klägers Otto Lindau an Befreiungssenator Lifschütz vom 29. April 1948 hervor. Auf diesen Brief wird noch genau einzugehen sein.
Seite 53
In der britischen Zone gab es ein sogenanntes Fragebogen-Prüfungsverfahren, das nur die beiden Kategorien „belastet“ (positive) und „unbelastet“ (negative) kannte. Wer den Antrag von Fritz überprüft hat und welche Unterlagen dafür verwendet wurden, ergibt sich nicht aus den Akten. Klar ist nur, dass man seine Bremer Entnazifizierungsakte nicht zu Rate gezogen hatte.[169] Sein Antrag wurde schon am 21. Oktober von der britischen Militärregierung in Stade angenommen. Er hatte offensichtlich nur die notwendigen bürokratischen Instanzen der Armee durchlaufen, ohne dass Fritz einer politischen Prüfung unterworfen worden wäre. Am 14. Dezember erhielt er mit der Bestätigung seiner „negative“ Kategorisierung von höchster britischer Stelle in Stade noch eine Bescheinigung über die Freigabe seines Vermögens, die als Kopie an die „Property Control“ des Entnazifizierungsausschusses in Rotenburg gegangen war.[170]
Die Frage war nun, ob die amerikanische Militärregierung, bzw. der Bremer Befreiungssenator diese Entscheidung akzeptieren würden. Auf den „Revisions“-Antrag von Fritz vom 4. November 1946 hatten die Amerikaner noch nicht reagiert, und es war nicht absehbar, ob und wann sie es tun würden. Fritz wurde deshalb auch in Bremen gleichzeitig aktiv. In den Akten liegt das Schreiben von Carl Schwarz vom 10. Januar 1947, dem – nach eigener Aussage – „bevorzugten Artistenvermittler“ von Fritz an einen Herrn Oberländer, „Leiter der Entnazifizierungs-Hauptstelle der amerikanischen Militärregierung“. Dieses Schreiben fand Eingang in die Entnazifizierungsakte unter dem Stichwort „Additional Information“. Schwarz, der Oberländer persönlich kennengelernt hatte, schrieb, „dass Fritz damals Flüchtlinge (Antifaschisten) schützte, aufnahm und den Weg nach Holland ermöglichte, ist mir von Amts wegen (!) bekannt geworden. Ich berufe mich hierzu auf das Zeugnis des einstigen Generaldirektors des Direktorenverbandes Josef Milos (!), Berlin-Neukölln“.[171] Ob die „Special Branch“ den Hinweis von Schwarz auf den Zeugen Milos aufgegriffen und diesen vernommen hat, lässt sich nicht feststellen. Tatsache ist, dass sich Napoli davon nicht hat beeindrucken lassen. Zu beachten ist, dass Schwarz sich lediglich auf die Zeugenaussage von Milos stützt. Er konnte also in Sachen Widerstand keine sachdienlichen Hinweise geben.
[169] Das geht aus dem endgültigen Urteil im Spruchkammerverfahren Fritz des öffentlichen Klägers Friedrich Frese vom 8. Juli 1948 hervor, in dem er begründete, warum die Entnazifizierung in Sottrum, bzw. Rotenburg in Bremen nicht anerkannt werden konnte.
[170] Die beiden Entscheidungen der britischen Militärregierung befinden sich als notariell beglaubigte Kopien in
der Entnazifizierungsakte von Fritz. StAB, a.a.O. Alle sonstigen Angaben finden sich im Schreiben von Wentzien vom 2. Juli 1947
[171] Brief von Carl Schwarz an den Leiter der Entnazifizierungshauptstelle der amerikanischen Militärregierung,
Oberländer vom 10. Januar 1947. E-Akte Fritz, Dokument 188. Über Oberländer gibt es in der Akte keine
weiteren Informationen. In den geschichtlichen Darstellungen der Bremer Entnazifizierung erscheint sein
Name nicht. Welche Aufgabe er in der „Denazification Divison“ des „Special branch“ gespielt hat, lässt sich
nicht feststellen. Leiter dieser Abteilung war der amerikanische Offizier Joseph F. Napoli.
Seite 54
Unvermittelt tauchte in den Akten am 24. April 1947 eine „Bescheinigung“ des „Entnazifizierung-Ausschusses für den Landkreis Rotenburg/Hannover“[172] auf, die eingangs feststellte, dass gegen Herrn Emil Fritz keine „irgendwelchen politischen Bedenken“ vorlägen. Es sei „erwiesen. dass der Appellant nur nominelles Mitglied der NSDAP war. Darüber hinaus steht jedoch einwandfrei fest, dass Fritz in den Jahren 1934 (! – d.Verf.) bis 1945 vielfach erheblichen Widerstand gegen das Regime geleistet hat und dafür mehrfach außerordentlich gemaßregelt worden ist (! – d.Verf.). Entscheidend jedoch für seine antifaschistische Einstellung und Gesinnung ist, dass er der Widerstandszentrale (!- d. Verf.) der Berufsorganisation in Berlin angehört hat und als norddeutscher Vertrauensmann in vielen Fällen jüdische Artisten und Betriebsinhaber auf Anordnung der illegalen Widerstandsbewegung über die holländische Grenze geschleust hat.“ Das Dokument ist unterzeichnet mit„Der Vorsitzende Köster“. Von der Form her ist es – wenn man vom Briefkopfabsieht – ein privates Entlastungsschreiben,denn es nimmt weder Bezug auf ein Verfahren, das der Entscheidung zugrunde liegt, noch nennt es einen Adressaten. Es ist Fritz wahrscheinlich privat auf dem Postweg zugegangen. Die Formulierungen stimmten zum Teil wörtlich mit den Aussagen des Josef Milos überein. Den Grund dafür finden wir im letzten Absatz des Schreibens: „Zeuge dafür ist der Leiter der illegalen Abwehrorganisation, Herr Josef Milos in Berlin-Neukölln, Beddinstr. 5,[173] der heute Leiter des Fachbeirats Kunst beim Magistrat der Stadt Berlin ist und mir diese Angaben persönlich bestätigt hat.“ Es war Milos‘ erster persönlicher Auftritt in Sachen von Fritz‘ Entnazifizierung, und es muss ein sehr überzeugender gewesen sein, denn er reichte aus, um diese Stellungnahme – außerhalb des offiziellen Verfahrens – auf den Weg zu bringen. Dieses Dokument spielte im laufenden Verfahren keine Rolle mehr, ist aber insofern doch interessant, als es belegt, dass die Widerstands-Geschichte des Emil Fritz schon weite Kreise gezogen hatte.
[172] Dok 81
[173] Der Straßenname ist falsch wiedergegeben. Es handelte sich um die Boddinstraße.
Seite 55
Die zwei Leben des Emil Fritz

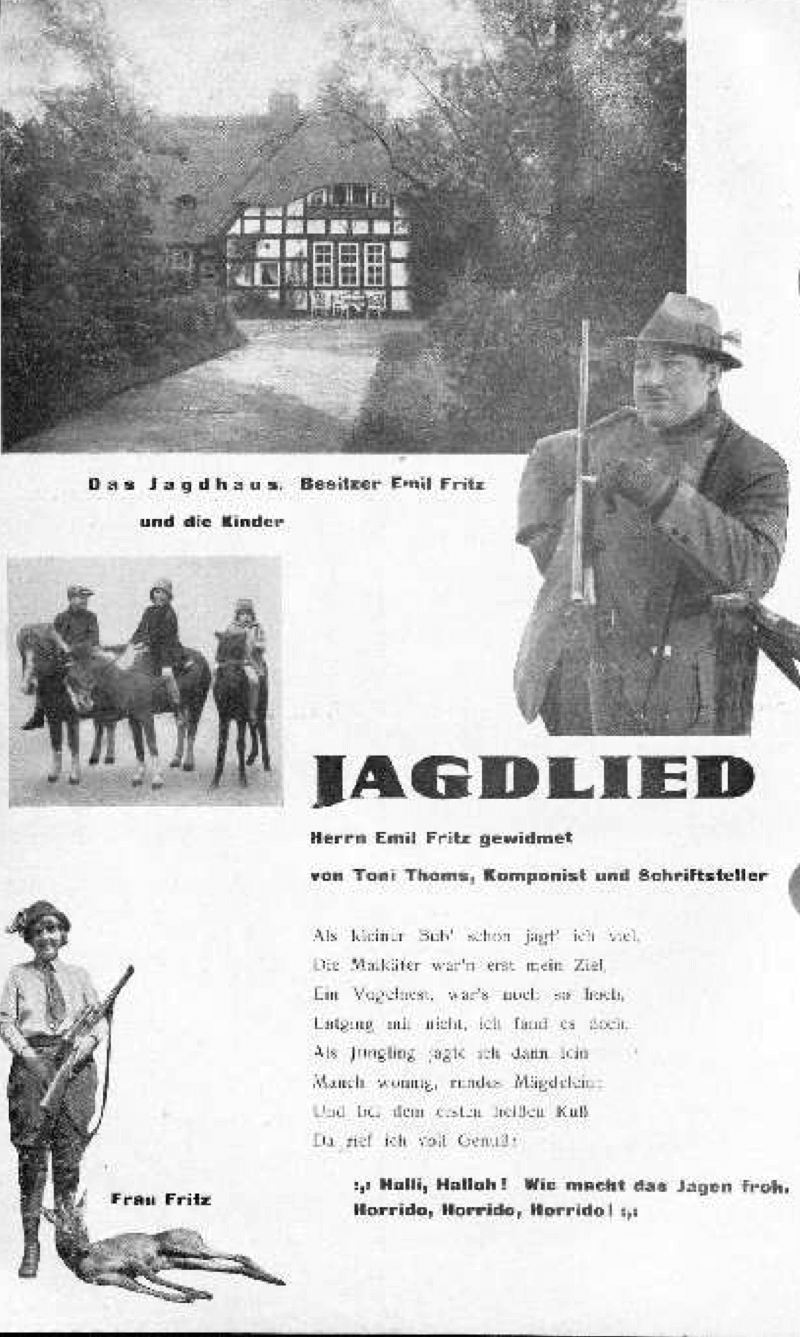
Seite 56
Jagdlied
Herrn Emil Fritz gewidmet
Von Toni Toms, Komponist und Schriftsteller
Als kleiner Bub‘ schon jagt‘ ich viel.
Die Maikäfer war’n erst mein Ziel.
Ein Vogelnest, war’s noch so hoch
Entging mir nicht, ich fand es doch.
Als Jüngling jagte ich dann fein
Manch sonnig, rundes Mägdelein.
Und bei dem ersten heißen Kuss
Da rief ich voll Genuss:
Halli, Halloh! Wie macht das Jagen froh,
Horrido, Horrido, Horrido!

Warum waren die Sottrumer, bzw. war der Rotenburger Entnazifizierungsausschuss so erpicht darauf, Fritz zu entnazifizieren? Sicher spielte eine Rolle, dass Fritz, wie dargestellt, schon vor dem Ersten Weltkrieg Pächter der „Grossottrumer Jagd“ war.
Seite 57
Als ihm die Gemeinde Sottrum 1919 Mitteilung machte, dass sie einen Teil davon an einen Freiherrn Alexander von Hammerstein abtreten wollte, sträubte sich Fritz in einem Schreiben vom 13. Oktober 1919 (Text s.u.) vehement dagegen. Auf diese Weise erfahren wir, dass er eine jährlich Jagdsteuer von 2630.- RM an die Gemeinde zahlte. In seinem Schreiben erklärte er sich auch damit einverstanden, auch die bevorstehende gesetzliche „große Reichs-Jagdsteuer“ von etwa 1500.- RM zu bezahlen. Von seinen erheblichen Ausgaben für die laufenden Jagden, von deren Höhe wir aus einer Zusammenstellung seiner Ausgaben aus dem Jahr 1933 wissen, als sie sich auf 5678.- RM beliefen,[174] dürfte mancher Betrag den Sottrumern zugutegekommen sein. Seit 1918 hatte er auch einen eigenen Revierjäger und Verwalter. In seinem Antrag vom 19. Oktober 1919 hatte er in Aussicht gestellt, sein Jagdhaus von Sottrumer Handwerkern bauen zu lassen, wenn die Gemeinde ihm die Einheit seines Jagdreviers, den Fährhof 5[175] eingeschlossen, zusichern würde. Wie wir wissen, wurde das Haus gebaut. Wir können also davon ausgehen, dass Fritz seit Jahrzehnten – nicht zuletzt auch wegen seiner Steuerzahlungen – ein sehr gutes Verhältnis zu den Sottrumern hatte. Man erzählt dort noch heute, dass die Sottrumer gerne Gast im Astoria waren. Im Jagdhaus des Lebemanns Fritz dürfte auch so mancher feuchtfröhliche Herrenabend mit der Sottrumer Prominenz stattgefunden haben, wie wir es von Zeugen aus der Zeit mit dem Bremer Bürgermeister Böhmcker wissen.
Warum man sich in Sottrum absolut nicht für Fritz‘ Nazi-Vergangenheit interessierte, erschließt sich auch bei einem Blick auf die politischen Verhältnisse ebendort.[176] Die Gemeinden Groß-Sottrum und Klein-Sottrum hatten 1925 1167 Einwohner. Bis in die Mitte der zwanziger Jahre dominierte politisch die Deutsch-Hannoversche Partei, die „Welfenpartei“, die für die Wiederherstellung des Landes Hannover und die Abtrennung von Preußen eintrat. Bei der Volksabstimmung für die entschädigungslose Enteignung der Fürstentümer gab es 1926 nur 5% der Stimmen. Bei den Reichstagswahlen 1928 und 1930 war die welfische Partei zwar noch immer die stärkste Kraft in Sottrum (1930: 50%), aber die NSDAP stand schon an zweiter Stelle (1930: 26%).
[174] Beilage der Aussage von Hasché vom 15. August 1946. Dok 95. E-Akte – Aussage Hasché vom 15. August
1946. Dok 92.
[175] Ein Grundstück mit der Bezeichnung „Fährhof 5“ gibt es heute noch in Sottrum. Es dient der Kaffee-Dynastie Jacobs als Gestüt für die Zucht von Pferdehengsten. Ein Betreten des Grundstücks ist wegen der wertvollen Tiere strengen Sicherheitsvorkehrungen unterworfen. Als zwischen 1993 und 2003 ein Pferderipper“ im norddeutschen Raum, auch in Niedersachsen, sein Unwesen trieb, ließ Jacobs seine wertvollsten Tiere mit dem Flugzeug ins Ausland transportieren.
[176] 800 Jahre Sottrum 1205 – 2005. Hrsg. Vom Heimatverein Sottrum e.V., Sottrum 2005, 416 Seiten. Die folgenden Angaben sind diesem Werk entnommen, wenn nichts anderes angegeben ist. Die Seitenzahlen in Klammern dahinter.
Seite 58
Bei der Neuwahl des Landtags im April 1932 wurde die NSDAP mit 61% der Wählerstimmen die mit Abstand stärkste Partei (Deutsch Hannoversche Partei: 19%). Das änderte sich auch bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 nicht. Die SPD hatte in Sottrum nie eine Chance (1932 8,5% der Wählerstimmen), von der KPD gibt es so gut wie keine Spur. Die Heimatchronik kommt in ihrer ausführlichen und sorgfältigen Darstellung zu der „ziemlich sicheren“ Erkenntnis, „dass die große Mehrheit der hiesigen Menschen die Machtergreifung Hitlers zu diesem Zeitpunkt ehrlich begrüßt hat.“ (S.127) Der Berichterstatter über die „Herbstversammlung des Landwirtschaftlichen Vereins“ im November 1933 „schwärmte“ von der begeisterten Stimmung, die für ihn ein Beweis war, „dass die Bauern des Kirchspiels Sottrum die wirtschaftspolitischen Ziele unseres Führers ebenso klar erkannt haben wie die politischen. Nicht umsonst wurde Sottrum eine nationalsozialistische Hochburg genannt.“[177] Von Bemühungen um eine Entnazifizierung in Sottrum konnte unter diesen Umständen nach dem Krieg keine Rede sein. Fritz konnte ohne weiteres an die Kontakte mit seinen guten Bekannten in Sottrum anknüpfen, wie das beigefügte Foto zeigt. Denn man blieb politisch weit rechts. Franz Heinecke, der erste frei gewählte Bürgermeister nach dem Krieg, gehörte der stramm rechtsgerichteten Deutschen Partei an. Fritz hatte mit Recht auf die Unterstützung der Sottrumer bei seinen Entnazifizierungsbemühungen gesetzt.[178]
[177] Rotenburger Anzeiger vom 28. November 1933. Zitiert aus: 800 Jahre Sottrum, a.a.O., S. 128.
[178] Die einzige Spur einer Entnazifizierung in Sottrum ist die Internierung der beiden NSDAP-Ortsgruppenleiter,
die 1948 als „Mitläufer“ eingestuft wurden. (800 Jahre Sottrum, a.a.O., S.138)
Seite 59

Fritz; rechts der Sottrumer Bürgermeister Franz Heinecke mit Frau; links Wilhelm Röhrs mit Frau, Gastwirt in Sottrum; Privatarchiv Arndt Frommann
Von der ungetrübten Stimmung in Sottrum unmittelbar nach Kriegsende zeugt ein Foto von 1946, das Fritz in seinem Jagdhaus mit dem Sottrumer Bürgermeister zeigt.
Seite 60
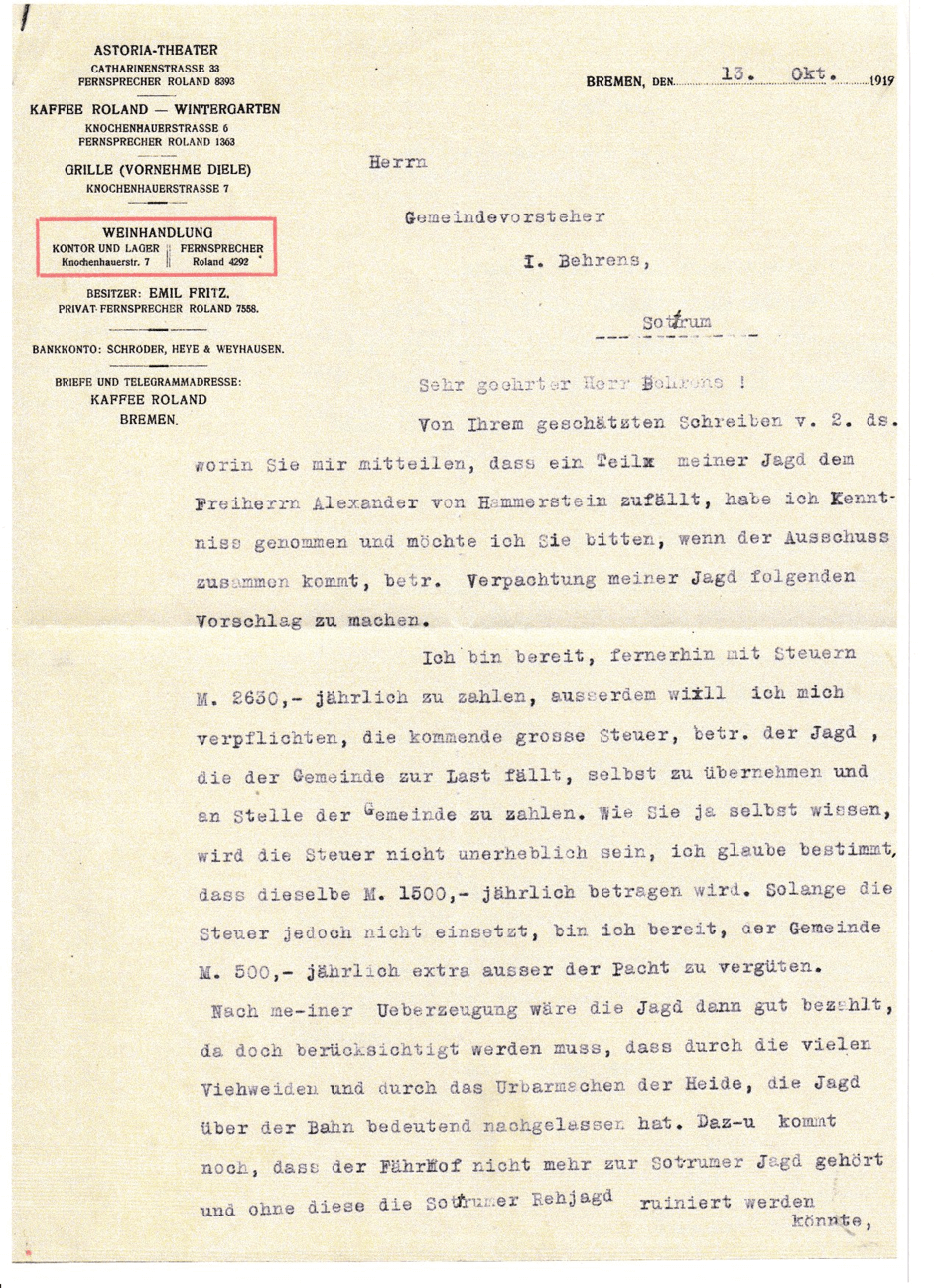
Seite 61
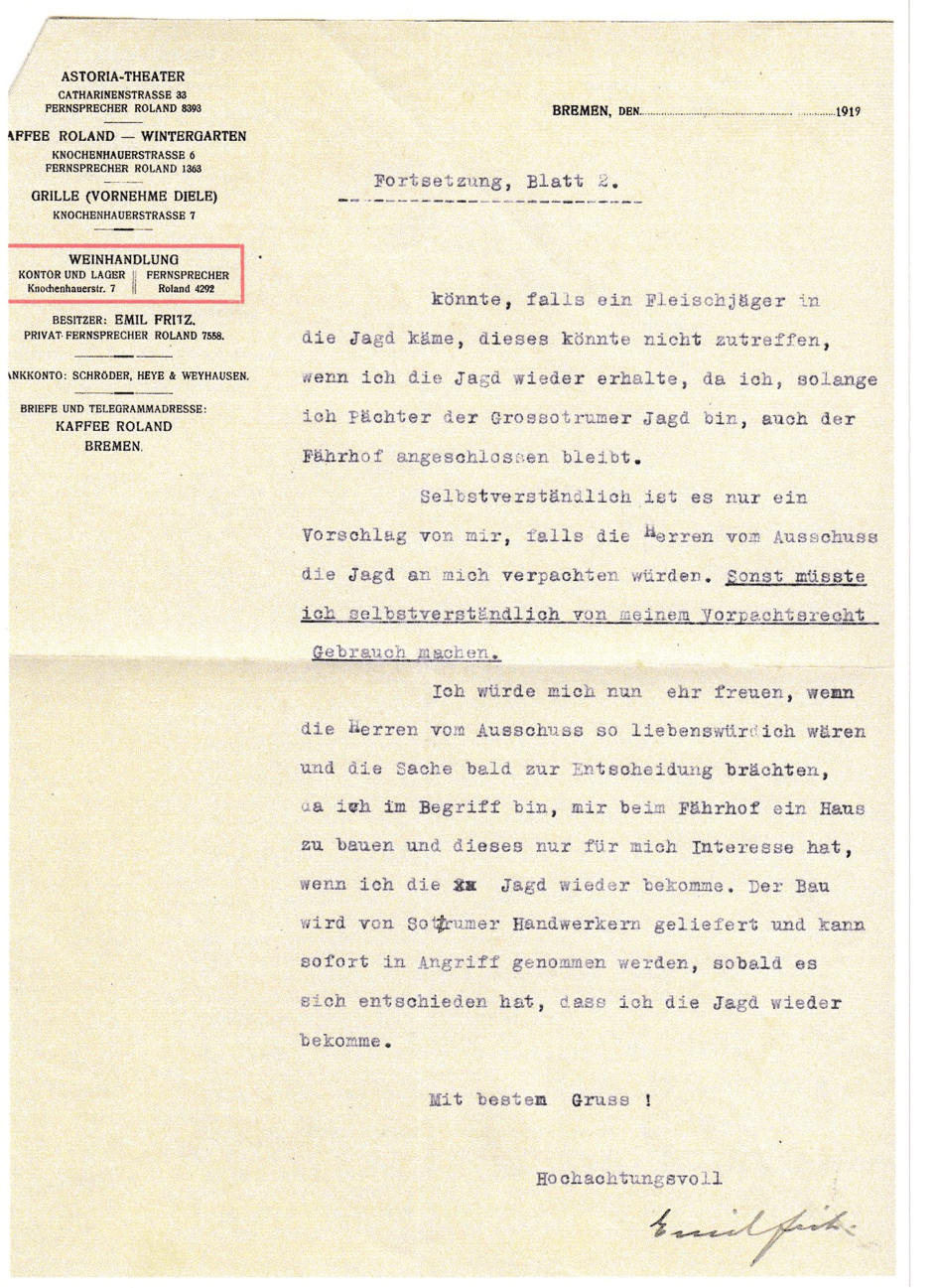
Seite 62
Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch Befreiungssenator Aevermann
Am 9. Mai 1947 wurde das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ [179] in der Bremer Bürgerschaft verabschiedet. Im Rahmen des Gesetzes wurde Friedrich Aevermann zum ersten Senator für politische Befreiung ernannt. (Offizieller Titel: Senator für die Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus).[180] Er verfügte über eine eigene Behörde. Trotz seiner erfolgreichen Entnazifizierung durch die britische Militärregierung und den Vorsitzenden in Rotenburg stellte Fritz am 19. Juni 1947 auch einen Entnazifizierungs-Antrag in Bremen.[181] Nach den guten Erfahrungen in Rotenburg schien er auch in Bremen hervorragende Erfolgsaussichten zu haben. Auf dem Meldebogen, den er dem Gesetz entsprechend ausfüllen musste, gab er unter „Bemerkungen“ an, dass er „als Verbindungsmann für Norddeutschland in der illegalen Abwehrbewegung des Theater- und Direktorenverbandes (…) aktiv gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet“ hätte. Außer Milos nannte er als Zeugen nur Carl Schwarz, über dessen auf Gerüchten beruhende Aussage wir schon berichteten. Sein Rechtsanwalt Wentzien nannte in seinem Schreiben vom 27. August 1947 die eidesstattliche Erklärung von Kurt Lindemeyer vom 1. November 1946 als „weiteres Belastungsmaterial“, obwohl Fritz sie schon mit seinem „Revisions“-Antrag vom 4. November 1946 eingereicht hatte. Lindemeyer, der in Düsseldorf eine Künstler-Agentur betrieb, hatte darin erklärt: „Im Jahre 1938 war es in Artistenkreisen allgemein bekannt geworden (!), dass Emil Fritz, weil er sich schützend vor Josef Milos gestellt hatte, in Bremen von Nationalsozialisten verprügelt worden ist. Die Artisten waren Emil Fritz dafür dankbar, dass er Milos gerettet hatte.“ [182] Auch diese Aussage beruhte auf einem Ondit.
[179] Es sah die Einrichtung von Spruchkammern vor, die sich aus einem öffentlichen Kläger, einem Vorsitzenden und zwei bis vier Beisitzern zusammensetzte. Am Ende des Verfahrens wurden die Betroffenen in eine der folgenden sechs Kategorien eingeteilt: Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer, Entlasteter und nicht vom Gesetz Betroffener.
[180] Friedrich Aevermann, 1887 – 1962, Lehrer im Bremischen Schuldienst. 1933 wegen politischer Tätigkeit für die SPD aus dem Schuldienst entlassen. Leitete ab 1946 den Hauptausschuss für Entnazifizierung. Vom 27. März bis zum 7. November 1947 war er Senator für Politische Befreiung. Er baute die Entnazifizierungsbehörde in Bremen, Contrescarpe 22/24, auf. Vgl. Wikipedia- Stichwort „Aevermann, Friedrich“.
[181] Das geht aus einem Schreiben von Fritz‘ Rechtsanwalt Wentzien vom 27. August vor an die Denazification Division für die bremische Enclave, z.Hd. von M. Napoli. Dort nennt er nur den Antragsmonat Mai.
[182] Eidesstattliche Erklärung von Kurt Lindemeyer vom 1. November 1946. Dok 48
Dem Umstand, dass die Erklärung von Lindemeyer das Datum vom 1. November trägt, ist keine besondere Bedeutung beizumessen. Sie wurde dem Revisions-Antrag vom 4. November gemeinsam mit den drei anderen Zeugen-Begleischreiben eingereicht. Die schriftliche Aussage von Josef Milos stand Lindemeyer schon seit dem 16. September im Büro von Fritz/Paßmann zur Verfügung.
Seite 63
Die Widerstandsgeschichte war inzwischen das zentrale Element im Verfahren geworden. Fritz blieb seiner Doppelstrategie treu und informierte weder die britische noch die amerikanische Seite über sein zweigleisiges Vorgehen.
Bis dato hatte es immer noch kein reguläres Entnazifizierungsverfahren in der britischen Zone vor einem deutschen Ausschuss gegeben. In der Entnazifizierungsakte findet sich noch ein „Entlastungs-Zeugnis“ (Clearance Certificate) der britischen Militärregierung in Rotenburg vom 24. Juni, aus dem hervorgeht, dass Emil Fritz, wohnhaft in Sottrum, Fährhof 5, „unter den Bestimmungen der Verordnung Nr. 79 der Militärregierung entlastet worden ist.“ Auf diesem Schreiben ist ein Stempelaufdruck mit dem umlaufenden Text „Entnazifizierungs-Ausschuss für den Landkreis Rotenburg-Hannover“ und die Unterschrift des Vorsitzenden der Denazifizierungs-Kammer, Köster. Man hatte sich in Rotenburg offensichtlich allein damit begnügt, die Entscheidung der britischen Militärregierung zu übernehmen. Wenn diese in Bremen anerkannt würde, müsste das Verfahren gegen Fritz niedergeschlagen werden.
Eben diesen Antrag stellte Rechtsanwalt Hermann Wentzien, der Fritz nun in immer zahlreicheren und längeren Einlassungen vertrat.[183] In einem viereinhalb Seiten langen Schreiben vom 27. August 1947 an die „Denazification Division der Militärregierung für die bremische Enclave“ bat er dessen Leiter, Joseph F. Napoli, „um die Freundlichkeit, dem Herrn Senator für politische Befreiung mitzuteilen, dass von Seiten Ihrer Regierung gegen die Einstellung des Spruchkammerverfahrens gegen den Betroffenen in Bremen keine Bedenken bestehen“ ersatzweise aber „um die Freundlichkeit, den Herrn Senator für die politische Befreiung aufzufordern, das Spruchkammerverfahren gegen den Betroffenen trotz der vorliegenden Entscheidung aus der britischen Zone sofort in Gang zu setzen.“ [184] Der amerikanische Offizier Napoli war am 1. August 1947 Leiter der „Denazification Division“[185] in Bremen und geworden und damit die höchste Autorität der amerikanischen Militärregierung in Sachen Entnazifizierung.[186] Die Spruchkammern in Bremen nahmen erst im August ihre Arbeit auf, unter anderem wegen der Schwierigkeiten, die der Befreiungssenator mit ihrer Besetzung hatte. In einer persönlichen und moralischen Erklärung fuhr Wentzien starkes Geschütz auf: „Ich fühle mich zu einem besonderen Einsatz in dieser Sache verpflichtet, weil dem Betroffenen m.E. durch den geschilderten Gang der Verfahren ein schweres Unrecht zugefügt worden ist.
[183] In der Akte liegen sieben Schreiben von Rechtsanwalt Wentzien mit insgesamt 12 Seiten.
[184] Schreiben an die Militärregierung für die bremische Enclave Denazification Division z.Hd. von M. R.(!) Napoli Bremen, Haus des Reichs. Dok 12.
[185] Am 22.3.1947 wurde die Denazification Division der amerikanischen Militärregierung geschaffen mit Special Branch Bremen, Inspection Branch und Investigation Branch, um den Herausforderungen des bevorstehenden Befreiungsgesetzes (das dann am 9. Mai von der Bürgerschaft verabschiedet wurde) gerecht zu werden. Amtsleiter wurde ein Jesse S. Morse.
[186] Er übte diese Tätigkeit bis zu ihrer Auflösung am 15.9.1948 aus. Danach war er bis zum 19.6.1949 noch “Denazification Adviser“ (Berater), bis auch diese Behörde am 30. Juni aufgelöst wurde. Joseph F. Napoli, (*24.9.1915 in New York; + 27.2.2004), stieß am 28.10.1946 zur Bremer Militärregierung. Am 11. Mai 1948 erhielt er eine schriftliche Belobigung von General Lucius D. Clay, dem Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, für seinen außerordentlichen Einsatz. Am 13.5.1949 gab er in Bremen eine Pressekonferenz, in der er sich kritisch zur Bremer Entnazifizierungspolitik äußerte. Im Juli 1949 erschien ein Artikel von ihm in Annals, Philadelphia 1949: „Denazification from an American‘ Viewpoint. Darin warf er den gewählten Vertretern des Landes Bremen vor, den Senator für Befreiung nur mangelhaft unterstützt zu haben. Er heiratete eine Bremerin. Vgl. Jansen/Meyer-Braun, a.a.O., S.150 und OMGUS. Handbuch. Die amerikanische Militärregierung in Deutschland 1945 – 1949, a.a.O., S.650, Anm. 114.
Seite 64
Es hat den Anschein, dass von bestimmten deutschen Kreisen gegen den Betroffenen unter dem Deckmantel des
Entnazifizierungsverfahrens ein wirtschaftlicher Kampf geführt wird, gegen den sich der Betroffene so lange nicht wehren kann, wie ihm in einem öffentlichen Verfahren eine Gelegenheit zur Rechtfertigung nicht gegeben wird.“ Es war, als hätte es nie zwei öffentliche Vorstellungsverfahren mit vorgeladenen Zeugen gegeben und als ob die amerikanische Militärregierung dafür verantwortlich wäre, dass Fritz schon seit einem Jahr eine Doppelstrategie verfolgte, die seine Angelegenheit für alle Beteiligten – mit Ausnahme der zu großer Form auflaufenden Rechtsanwälte – fast undurchschaubar machte. Wentzien schrieb, dass „aufgrund des Kontrollratsgesetzes Nr. 38 und der „Zonenexekutivanweisung 79 in der britischen Zone“ ein neues Spruchkammerverfahren in Bremen nicht mehr zulässig sei. Doch selbst wenn ein solches Verfahren in Gang gesetzt würde, hätte die Rotenburger Entscheidung schon deshalb Vorrang, weil sie der anderen vorausgegangen war. Es war die Frage, ob die juristische Entscheidungshilfe des deutschen Anwalts, so höflich sie auch vorgetragen wurde, dem Leiter der Denazification Division, Napoli, willkommen sein würde in einer Angelegenheit, die ausschließlich die Siegermächte zu entscheiden hatten.
Zunächst mit dem Fall befasst war der Öffentliche Hauptkläger Erich Buchenau. Schon zwei Wochen nach dem Antrag von Wentzien stellte er den Antrag, das Verfahren gegen Fritz wegen Unzuständigkeit der Spruchkammer des Landes Bremen einzustellen. (…) Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last.“ Er folgte, in verkürzter Form, der Argumentation von Wentzien,[187] ergänzte sie nur: „Nach Art. 31, Abs. 3 des Bremischen Gesetzes vom 9.5.47 ist die Zuständigkeit der Bremischen Spruchkammer nicht gegeben über diejenigen Personen, über deren Fall in einer der vier Zonen Deutschlands endgültig entschieden worden ist.“ Buchenau schickte seine Entscheidung an Wentzien, an die „Property Control“ der amerikanischen Militärregierung und an das Amt für Vermögenskontrolle Bremen. Auf den „Entblockungsantrag“ von Wentzien hin, wurde am 9. September das Vermögen von Fritz entsperrt.[188] Buchenau, gerade am 23. Juni in sein Amt gekommen, musste am 12. Juli, nur eine Woche nach seiner Entscheidung in Sachen Fritz, wieder gehen, weil die Militärregierung ihn wegen politischer Belastung ablehnte. Entscheidend war dabei nicht seine kurze Zeit in der SA, seine Mitgliedschaft im Rechtswahrerbund und im Stahlhelm, sondern sein von ihm verschwiegener Aufnahmeantrag in die NSDAP.
[187] Unter Umgehung des Begriffs „Gesetz“ nannte er das Kontrollratsgesetz Nr. 38 die „Anordnung 38 des Alliierten Kontrollrats.“ Diese Feinheiten spielten bei konservativen Juristen wie ihm eine nicht unerhebliche Rolle.
[188] Wentzien in einem Brief vom 18. November 1947 an die Militärregierung, z.Hd. von Mr. Napoli. Dok 64.
Seite 65
Er war „Anwärter“ auf die Mitgliedschaft. Das ging nun aus seinem Meldebogen vom 8. Juli hervor. Auch Befreiungssenator Friedrich Aevermann hielt Buchenau nach Bekanntwerden dieser Tatsache für untragbar.[189] Dieser musste sich dann selbst einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen.[190] Aevermann hob das Spruchkammer-Urteil von Buchenau auf[191]. Fritz‘ Vermögen wurde wieder gesperrt.
Ein Schreiben von Wentzien an den Öffentlichen Hauptkläger vom 18. August ging weit über diese juristischen Argumente hinaus. Die Entnazifizierung von Fritz bekam darin eine gesamtgesellschaftliche Dimension. Abgesehen von der juristischen Frage, schrieb er, erleidet auch die bremische Wirtschaft m.E. einen unwiederbringlichen Schaden, wenn Arbeitskräfte nach bereits stattgehabter Entnazifizierung dem Arbeitsmarkt durch eine unnötige Hinauszögerung der bremischen Entscheidung länger vorenthalten bleiben, als dies nach der Sach- und Rechtlage nötig wäre.“[192]
Zweite Einstellung des Verfahrens in Bremen – Aufhebung der Entscheidung durch den Öffentlichen Hauptkläger Hollmann
Der Fall ging an den öffentlichen Kläger Rechtsanwalt Helmuth Langer.[189] Er stellte keine eigenen Untersuchungen an, sondern bat lediglich den Entnazifizierungs-Ausschuss Rotenburg um Auskunft darüber, warum sie Emil Fritz von politischer Belastung freigesprochen hätten.[190] Die Antwort kam am 1. September und enthielt die lapidare Mitteilung, dass der Ausschuss Fritz am 24. Juni „gemäß den Bestimmungen der Verordnung Nr.79
[189] Vgl. zu diesem politischen Konflikt Hans Hesse, Konstruktionen der Unschuld, a.a.O., S.64/65.
[190] In der Klageschrift des öffentlichen Klägers vom 26.Januar 1948 wurde er als „Belasteter“ eingestuft. Die Spruchkammer stufte ihn aber am 27. Februar als „nicht vom Gesetz Betroffenen“ ein. Vgl. Hans Hesse, S.65.
[191] „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“, Art. 52 (1) „Der Senator für Befreiung kann sich jede Entscheidung zur Nachprüfung vorlegen lassen. (3) Der Senator kann die Entscheidung aufheben, die erneute Durchführung des Verfahrens anordnen und hierbei den Fall an eine andere Spruchkammer verweisen.
[192] Schreiben an den Herrn Generalkläger bei der Spruchkammer in Bremen, Contrescarpe vom 18. August 1947. Dok zu 14
[193] Langer war Mitglied der rechtsgerichteten Deutschen Partei (DP), die sich in den vierziger Jahren vor
allem für Wehrmachtsangehörige und Vertriebene und gegen Kommunismus, Sozialismus und Mitbestimmung
einsetzte. Vgl. Wikipedia, Stichwort Deutsche Partei vom 30.03.2021. Im Sommer 1949 kam es zu Angriffen
der DP auf Lifschütz, u. a. wegen dessen angeblicher nicht-deutscher Staatsangehörigkeit (Er hatte als Jude, der aus Deutschland geflohen war, die deutsche Staatsangehörigkeit verloren und zu dieser Zeit einen „Staatenlosen-Pass“.) Der Senat bezeichnete die Kampagne der DP als „neo-faschistische Umtriebe“. Einer der beiden Hauptverantwortlichen für diese Angriffe war Langer. Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 184/185. Die DP erzielte bei den Wahlen in Bremen 1951 noch 14,7% der Stimmen (die CDU 9,1%, die FDP 11,8%, die SPD
[194] Das Anschreiben befindet sich nicht in der Akte. Möglicherweise ist seine Anfrage fernmündlich erfolgt.
Seite 66
nach den Vorschriften über die Entnazifizierung“ in der britischen Zone entlastet hätte und dass die „in dem in Bremen laufenden Verfahren gegen den Antragsteller erhobenen Vorwürfe der Denazifizierungskammer Rotenburg bekannt (sind) und durch die vorgelegten Entlastungsbeweise widerlegt wurden. (…) Der Entlastungsbescheid (Clearance Certificate) ist rechtskräftig.“[195] Die Antwort enthielt keine Dokumente oder auch nur Hinweise darauf.
Es reichte Langer aber, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen wie Buchenau. In einem Schreiben vom 5. September teilte er Fritz‘ Rechtsanwalt Wentzien mit, dass Fritz aufgrund des Entlastungszeugnisses der Rotenburger Denazifizierungskammer „nicht mehr unter unsere Zuständigkeit“ fällt. Die Vermögenssperre werde aufgehoben.
Nach langen Bemühungen hatte Befreiungssenator Aevermann einen Nachfolger für Buchenau gefunden. Am 8. September übernahm der Kaufmann Heinrich Hollmann das Amt des Öffentlichen Hauptklägers. Hollmann war der Meinung, dass Fritz sehr wohl in die Zuständigkeit der Bremer Spruchkammern fiele, da er in den Jahren 1933 bis 1944/45 hier seinen Wohnsitz hatte und beruflich tätig war. Er veranlasste Langer, seine Mitteilung an Rechtsanwalt Wentzien zu widerrufen. Langer setzte ein entsprechendes Schreiben auf und bat in einem gesonderten Schreiben vom 3. Oktober an die amerikanische Militärregierung, Property -Control, „die erneute Blockierung des Vermögens, „da der Herr Hauptkläger des Landes Bremen nach neu auftauchendem Belastungsmaterial die Wiederaufnahme des Verfahrens beabsichtigt.“[196]
Wie sich aus einer Aktennotiz von Hollmann ergibt, wurde das Verfahren am 31. Oktober wieder aufgenommen. Fritz hätte „seinen dauerhaften Wohnsitz in Bremen, ebenso seinen Erwerb (Emil-Fritz-Betriebe)“. Deswegen unterstehe er „rechtlich der Spruchkammer Bremen“. Was die Entnazifizierung in Sottrum anginge, vermutete er, dass Fritz „Gründe hätte, sich in der britischen Zone entnazifizieren zu lassen, da in der dortigen Spruchkammer seine Einstellung zum 3. Reich nicht genügend klargestellt werden kann.“ Fritz sei auf jeden Fall höher einzustufen als in die Klasse der Entlasteten. „Ich ersuche um Meldebogenvorlage sowie evtl. Aktenanlegung und Heranziehung der Akte Sottrum. Die Deblockierung seines Vermögens ist zurückzuziehen.“ [197]Am gleichen Tag bat der öffentliche Kläger Langer in einem Schreiben an den Entnazifizierungsausschuss Rotenburg unter Hinweis auf das wieder aufgenommene Verfahren gegen Fritz „um Übersendung der dortigen Entnazifizierungs-Akte.“[197]
[195] Entnazifizierungs-Ausschuss für den Landkreis Rotenburg / Hann. Bescheinigung vom 1.9.1947.
[196] Der öffentliche Kläger an die Militärregierung. Dok zu 2.
[197] Aktennotiz vom 31.10.1947. Dok 5
[198] Schreiben Langers an den Entnazifizierungs-Ausschuss Rotenburg /Hann. Vom 31.10.1947. Dok zu 2)
Seite 67
Das war seine letzte Amtshandlung in Sachen Fritz.
Am 21. November wurde Alexander Lifschütz Senator für Befreiung als Nachfolger von Aevermann. Die Behörde wurde umstrukturiert. Die Abteilung der öffentlichen Kläger umfasste nun 125 Personen, von denen nur noch 67 einer Partei angehörten (von den 11 leitenden öffentlichen Klägern waren es fünf). Diese Entpolitisierung verlief parallel mit einem zunehmenden Desinteresse der Rechtsanwälte am Amt des öffentlichen Klägers, das vorzugsweise von Juristen besetzt werden sollte, was für die Vorsitzenden der Berufungskammern sogar Vorschrift war. Wie Wentzien, Buchenau und Langer – die beide sogar „die Seite wechselten“ – zogen sie es vor, als gut bezahlte Verteidiger von ehemaligen Nationalsozialisten tätig zu sein. [199]
Am 25. November beauftrage der Öffentliche Hauptkläger den parteilosen öffentlichen Kläger Otto Lindau mit der Durchführung eines neuen Spruchkammerverfahrens. Lindau war kein Jurist. Auf seinem Schreibtisch lag die Antwort des Vorsitzenden des Entnazifizierungsausschusses in Rotenburg auf die Anfrage von Langer vom 31. Oktober. Dieser hatte am 6. November seinerseits die Bremer Spruchkammer aufgefordert, „das dort befindliche neue Belastungsmaterial zur gefl. Einsichtnahme hierher zu übersenden, um die Wiederaufnahme des Verfahrens in die Wege zu leiten.“[200]. Am Tag seiner Amtseinführung, am 25. November, schrieb Lindau an den Denazifizierungsausschuss Rotenburg, warum Fritz in Bremen entnazifiziert werden müsste: „Der Betroffene, Emil Fritz, hat seinen Wohnsitz seit Jahrzehnten dauernd in Bremen gehabt. Auch seine diversen geschäftlichen Unternehmungen befanden sich alle in Bremen. Der Sottrumer Wohnsitz des Betroffenen war nur als eine Art Wochenendaufenthalt gedacht. Fritz untersteht daher rechtlich der Spruchkammer in Bremen. Ich beabsichtige, gegen den Betroffenen vor der hiesigen Spruchkammer ein Verfahren einzuleiten. Ich ersuche daher dringend, das dort anhängige Verfahren nach hier zu überweisen und das gesamte Material meiner Dienststelle zuleiten zu wollen.“[201]
[199] In der Bürgerschaftsdebatte vom 26. Februar 1948 sagte der KPD-Abgeordnete Rudolf Rafoth:“ Die Juristen seien „zwar jederzeit bereit (…) als Verteidiger von Nationalsozialisten Honorare von 10.000 Mark (…) zu kassieren, dass sie aber nicht bereit waren – oder mit wenigen Ausnahmen – als Öffentliche Kläger oder Spruchkammervorsitzende sich zur Verfügung zu stellen. Hans Hesse, a.a.O., S.118/119. Durch die Nachfrage nach Rechtsanwälten in die zunehmend justifizierten Verfahren entstand unter den Rechtsanwälten ein Kreis, der sich auf diese Thematik spezialisierte. In den Spruchkammerverhandlungen werden immer wieder die gleichen Anwaltskanzleien erwähnt.“ Auf der Basis von 138 Einzelakten betrug der stadtbremische Anteil der Kanzlei Buchenau und Partner 45% der Entnazifizierungsverfahren. Zu diesem Kreis gehörte auch Wentzien.. Vom 2. Juli 1947 bis zum 20. Mai 1948 verfasste Wentzien von der Sozietät Hogrefe/Wentzien allein sieben Schriftsätze in Sachen Fritz, von denen das vom 27. August allein fünf Seiten umfasste. Sein Partner Hogrefe lag mit 11 Entnazifizierungs-Verfahren an zweiter Stelle. A.a.O., S.258/259
[200] Schreiben an den Senator für politische Befreiung, Contrescarpe 22/24 vom 6. November. Dok 4
[201] Schreiben von Lindau an den Entnazifizierungsausschuss Rotenburg vom 25.November 1947. Dok zu1
Seite 68
Aus der Antwort des Rotenburger Ausschussvorsitzenden: „Feststehende Tatsache ist, dass der Genannte seit ca. 30 Jahren in Sottrum einen Hof von rd. 100 Morgen besitzt. Dies ist alles andere als ein Wochenendhaus. Seinen festen Wohnsitz und einzigen Wohnsitz hat Fritz seit etwa 5 Jahren in Sottrum. Für die Entnazifizierung war somit der Ausschuss Rotenburg zuständig. Der Fall Fritz ist hier abgeschlossen. Die Akten befinden sich bei der Militärregierung.“[202] In Fritz‘ Nachlass findet sich als „landwirtschaftliches Grundvermögen“ lediglich der Fährhof 5 mit Jagdhaus in einem Verkehrswert von 65.000 DM.[203] Diese Summe ist nicht mit den angeblichen 100 Morgen Grundbesitz in Einklang zu bringen. Ob die Rotenburger hier großzügig Fritz‘ gepachtetes Jagdrevier als „Besitz“ angegeben, oder sich in der Größe des „Hofes“ geirrt haben, sei dahingestellt. Landwirtschaft hat Fritz jedenfalls nie betrieben.
Mit diesem Brief verabschiedeten sich die Rotenburger aus dem Verfahren. Es gibt in der Fritz-Akte kein Dokument mehr vom Entnazifizierungsverfahren in Rotenburg.
Der Vorsitzende der Spruchkammer Lindau blickt nicht mehr durch
Am Ende des Jahres 1947 war das Vermögen von Fritz immer noch blockiert und seine Entnazifizierung nicht in Sicht. Er beantragte deshalb am 27. November über seinen Rechtsanwalt Wentzien beim öffentlichen Kläger, das Verfahren gegen ihn einzustellen und die Vermögenssperre aufzuheben. Im dazugehörigen Fragebogen der Spruchkammer hatte Fritz erklärt, dass er „seit seiner Entlassung als Varieté-Direktor“, also seit Dezember 1945 „von der eigenen Landwirtschaft“lebt und verwies im Übrigen auf seine politische Entlastung in der britischen Zone.[204] Unabhängig vom Ausgang der juristischen Auseinandersetzung über die Gültigkeit der Rotenburger Entscheidung, hatte er ein Pfund in der Hand, mit dem sich wuchern ließ. Seine Widerstandsgeschichte in der Fassung von Josef Milos war inzwischen in alle Entscheidungen als gegeben aufgenommen worden.
[202] Schreiben des Entnazifizierungsausschusses Rotenburg an den öffentlichen Kläger bei der Spruchkammer Bremen vom 28. November 1947. Dok zu 4.
[203] Nachlass Emil Fritz, Testamentsvollstreckung, III Landwirtschaftliches Grundvermögen. Notarielle „Ausfertigung“ von Notar J.H. Wentzien vom 22.2.1956. StAB 4,75/5-4192.
[204] Spruchkammer Bremen. Der öffentliche Kläger. Fragen an den Betroffenen. Darauf sind zwei Daten genannt: der 27. November und der 8. Dezember 1947. Dok 7.
Seite 69
Es war vorauszusehen, dass juristischen Fragen dahinter zurücktreten würden. So drückte es Rechtsanwalt Wentzien vorausschauend in seinem Antrag an den öffentlichen Kläger aus, der nun Lindau war: „Allein die Vernehmung des bekannten Antifaschiste M i l o s, Direktor des Internationalen Varietétheaterdirektorenverbandes würde nach Ansicht der Verteidigung alle etwaigen belastenden Gerüchte zerstreuen und die Einstufung des Betroffenen in Stufe V als Entlasteter rechtfertigen.“ Im Fall der Fälle „würde die Vernehmung von Dir. M i l o s aus informatorischen Gründen Licht in die Sache bringen.“[205]
Am 29. November, zwei Tage nach dem Antrag, nur vier Tage nach der Übernahme des Spruchkammerverfahrens durch Lindau, erschien Milos „aus freien Stücken“ bei ihm persönlich, um eine Aussage zu machen. Lindau lud ihn nicht vor die Spruchkammer, wie es seine Pflicht gewesen wäre, sondern nahm die Aussage unter vier Augen entgegen, machte davon ein Protokoll, das nur von ihm und Milos unterzeichnet war und legte es zu den Akten des Verfahrens.[206] Auch diesmal nannte Milos keine Zeugen – weder aus dem Kreis der „Abwehrbewegung“, noch aus dem der Geretteten und ihrer Angehörigen. Lindau übernahm, wie aus seinem späteren Urteil hervorgeht, die Aussagen von Milos eins zu eins, ohne ihm auch nur eine Frage zu stellen.
Am 4. Dezember schickte Lindau einen Brief an den neuen Leiter der Rechtsabteilung beim Senator für Befreiung, Rechtsanwalt K. Fr. Roeder. Es gälte nun, schrieb er, „eine juristische Flickschusterei zu lösen. Als Nichtjurist finde ich mich durch den Irrgarten der nebeneinander und durcheinander laufenden Verfahren nicht zurecht.“ Er bat um juristische Auskunft zu drei Fragen: 1. Ist das Verfahren in Bremen nach der Entnazifizierung in Rotenburg zulässig? 2. Wenn nein, müsste dann nicht die Vermögenssperre gegen Fritz aufgehoben werden? 3. „Wenn ja, haben wir nach dem Bremer Gesetz eine gesetzliche Handhabe, die Property Control der Mil.Reg. dazu zu zwingen…?“ Wieso Lindau seinen vor zehn Tagen im Brief an den Rotenburger Entnazifizierungsausschuss so überzeugend begründeten Standpunkt über die Notwendigkeit einer Entnazifizierung in Bremen in sein Gegenteil verkehrte, lässt sich nur vermuten. Wenn man allerdings seine Ausführungen am Ausgang des Verfahrens berücksichtigt, geht man wohl nicht fehl in der Annahme, dass es unter dem Eindruck geschah, den Milos‘ Aussagen auf ihn gemacht hatten.
[205] Schreiben an den öffentlichen Kläger bei der Spruchkammer in Bremen vom 27. November 1947. Dok zu 22.
[206] Vernehmungsprotokoll vom 29. November 1947. Dok zu 10.
Seite 70
Roeder antwortete am 12. Dezember:
1) „Nach der endgültigen Erledigung der Angelegenheit Emil Fritz in der englischen Zone ist für ein Spruchkammerverfahren kein Raum mehr.
2) Die Vermögenssperre (…) gegen den Betroffenen ist aufzuheben.
3) Irgendwelche Handhabe allerdings gegen die Militärregierung diese zu erzwingen, sehe ich nicht.
4) Es dürfte sich empfehlen bei der Mil.Reg. festzustellen welche Bedenken gegen Herrn Emil Fritz von Seiten der Mi.Reg. erhoben werden.“
Lindau blieb also nichts anderes übrig, als das Spruchkammerverfahren in die Wege zu leiten.
Am 31. Januar 1948 trat der Öffentliche Hauptkläger Heinrich Hollmann, politisch resigniert, zurück. Sein Nachfolger wurde Rechtsanwalt Roeder. Durch das Versehen eines Sachbearbeiters erfolgte ein öffentlicher Zeugenaufruf in Sachen Emil Fritz „durch Aushang und Rundfunk,“ wie er eigentlich nur für neue Verfahren üblich war.[207] Die Spruchkammer unter Vorsitz von Lindau gab Fritz in drei Sitzungen Gelegenheit, sich noch einmal ausführlich zur Sache zu äußern. Die Ausschuss-Protokolle, die sich über fünfeinhalb einzeilig gedruckte DIN A4 Seiten erstreckten, waren zwar mit „Vernehmung“ überschrieben, gaben aber nur die Aussagen von Fritz wieder, ohne dass ihm – mit einer Ausnahme – Fragen gestellt worden wären. In seiner ersten „Vernehmung“ vom 18. Dezember 1947[208] stand seine angebliche Abwehrtätigkeit im Mittelpunkt, die er mit Einzelheiten ausschmückte, deren Wahrheitsgehalt nicht überprüfbar waren. Was den Beginn seiner Mitarbeit anging, so hielt er seine Behauptung aus dem „Revisions“-Antrag“ vom 11. November 1946 nicht mehr aufrecht, dass er „schon 1933 der illegalen Abwehrbewegung beigetreten“ wäre. Er entschied sich für die Fassung von Milos aus dessen eidesstattlicher Erklärung vom 28. Dezember 1946, dass diese erste 1937 begonnen hätte. Er erwähnte die in seinen „bisherigen Verfahren schon genannten Juden“. In seiner zweiten „Vernehmung“ vom 23. Dezember ging er auf die Anfänge des Astoria in der Nazizeit ein und auf seine angeblich von Anfang an geführten Kämpfen gegen Staatsrat von Hagel. Hier wurde ihm die einzige Frage gestellt. Sie bezog sich auf das Hitler-Plakat am Atlantic-Café im August 1933, von dem Fritz wieder behauptete, dass es gegen seinen Willen von der DAF angebracht worden wäre. Dazu machte er eine Falschaussage.
[207] Das geht aus einem Brief von Lindau an Senator Lifschütz vom 29.4.1948 hervor.
[208] Vernehmung am 18. Dezember 1947 in eigener Sache. Zwei Unterschriften, darunter Lindau. Dok 8
Seite 71
Er verlegte die Aktion in die Zeit, als „der Führer zum ersten Mal Bremen zur geplanten Brückeneinweihung,“ besuchen wollte, also auf den 1. Juli 1939. Seine Aussage endete mit der blutigen Darstellung, wie er seinerzeit Josef Milos gegen „ca. 8 SS-Leute“ unter Lebensgefahr gerettet hatte. Die dritte Aussage am 29. Dezember machte er auf eigenen Wunsch zusätzlich. Darin ging es um das Astoria-Programmheft von 1934, das, wie er einräumte, „nationalsozialistische Propaganda enthielt.“ Hierzu erklärte er, dass nicht er für den Inhalt dieses Programms verantwortlich zeichnete, sondern sein Direktor Hasché.“
Nur zwei Belastungszeugen hatten sich nach dem öffentlichen Zeugenaufruf gemeldet: Willi Hasché und Frau Herm. Siemer. Am 17. Januar 1948 übergab Hasché der Spruchkammer eine zweiseitige Erklärung. Darin wiederholte er die Aussagen, die er im Frühjahr 1946 vor dem Untersuchungsausschuss gemacht hatte. Er nannte weitere Einzelheiten zu den Spenden und der Art, wie Fritz sie übergeben hatte. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Aussage der Sekretärin Jane Schuhmann im Vorstellungsverfahren, die seine Angaben bestätigt hatte. Hasché schilderte noch einmal ausführlich die Geschichte mit dem Hitler-Portrait am Atlantic im August 1933.
Am 27. Januar 1948 erreichte die Spruchkammer das Schreiben der zweiten Belastungszeugin. Frau Herm. Siemer[209], der Inhaberin der Weinstuben Bardinet in der Katharinenstraße Nr. 21. Sie schilderte noch einmal die Geschichte des Hitler-Plakats am Atlantic-Café neben ihren Weinstuben Bardinet in aller Ausführlichkeit unter Angabe weiterer präziser Einzelheiten zum Datum und zum Ablauf des Geschehens. Lindau hielt es nicht für nötig, die beiden letzten Belastungszeugen noch einmal vorzuladen und zu befragen.
Diffamierungen und Verleumdungen – Die dunkle Seite des Emil Fritz
Unliebsame Zeugen aus der Reihe der leitenden Angestellten, die seine engen Kontakte zu den Bremer Nationalsozialisten bezeugten, überzog Fritz mit pauschalen Diffamierungen, indem er sie als „absolut unzuverlässig“ beschrieb – so Georg Meyer, der von 1930 bis 1936 das Astoria-Kabarett leitete und für die Artistenauswahl zuständig war, oder Amandus Völk, seit 1941 Stellvertretender Direktor der Emil-Fritz-Betriebe: „Die Angaben von Völk (…) sind im Wesentlichen unwahr.
[209] „Herrn öffentlicher Kläger bei der Spruchkammer Bremen, Contrescarpe“ vom 27. Januar 1948.
Seite 72
Völk hat sich als absolut unzuverlässig entpuppt.“[209] Willi Hasché, als Direktor des Hotels „Europäischer Hof“ ein anerkannter Hotelier in der Stadt war als leitender Direktor der Emil-Fritz-Betriebe von September 1932 bis Mai 1934 ein Schwergewicht unter den Belastungszeugen. Gegen ihn fuhr Fritz von Anfang an schweres Geschütz auf. Es begann im Frühjahr 1946 im zweiten Vorstellungsverfahren vor dem Untersuchungsausschuss IV, als er die Zuverlässigkeit des Zeugen Hasché durch die Behauptung zu erschüttern versuchte, dass er ihn wegen Diebstahls entlassen hätte und dass er sich in seinen Aussagen von Rachegefühlen leiten lassen würde. Der Ausschuss gab Hasché Gelegenheit, diesen Vorwurf zu entkräften. Hasché legte Dokumente vor, aus denen hervorging, dass es im Zusammenhang mit der Kündigung tatsächlich zu einem arbeitsrechtlichen Streit gekommen war. Zunächst war alles in geordneten Bahnen verlaufen, als Fritz im Mai 1934 Hasché schriftlich gekündigt hatte. Er sei, schrieb er, dazu gezwungen, „den von Hasché innegehabten Posten mit einem anderen Ressort zu vereinigen, so dass sich hieraus das Ausscheiden des Herrn Hasché aus meinem Betrieb“ ergibt.“[210] Hasché forderte daraufhin in einem Schreiben die Erfüllung finanzieller vertraglicher Verpflichtungen, die Fritz seit November 1933 nicht eingehalten hätte. Es handelte sich u.a. um vertraglich festgelegte monatliche Zulagen von 100 RM und um Bar-Entschädigung für nicht genommenen Urlaub von insgesamt etwa 2000 RM. Bei Nichterfüllung drohte Hasché mit arbeitsgerichtlicher Klage. Fritz inszenierte daraufhin, anders lässt sich das nicht ausdrücken, einen Diebstahl des Willi Hasché. Er ließ einen seiner Angestellten, den Dekorateur Erich K.[211] in die Wohnung von Hasché eindringen, der in den E-F.-Betrieben wohnte. K. requirierte dort Stoffreste und angeblich auch Lampenschirme, die Fritz als Diebesgut aus dem Bestand des Betriebes deklarierte. Mit einer fristlosen Kündigung wegen Diebstahls hätte Fritz die Auszahlung der geforderten Geldbeträge vermieden. K., hatte am 6.August 1946 vor dem Untersuchungsausschuss die eidesstattliche Erklärung abgegeben, „dass der frühere Geschäftsführer Hasché im Betrieb gestohlen hat. Ich selbst habe die gestohlenen Sachen (Decken, Lampenschirme) aus seiner Wohnung herausgeholt. Herr Hasché ist daraufhin entlassen worden.“ Erich K., am 6. April 1948 erneut als Zeuge in dieser Angelegenheit vernommen, nahm vor den Ermittlern seine Aussage zurück. Er gab zu, „von den in seiner eidesstattlichen Erklärung erwähnten Lampenschirmen nichts zu wissen“.
[209] Aussage in einem Schreiben vom 29. Mai 1946 an den Unterausschuss IV.
[210] Arbeitszeugnis für Willi Hasché vom 8. Juni 1934, ausgestellt von Emil Fritz. Dok 98.
[211] Wir verzichten hier auf die volle Namensnennung.
Seite 73
Die Erklärung sei „von Frau Paßmann geschrieben worden.“[212] Aus den Dokumenten von 1934 ging hervor, dass es in Wirklichkeit zu einer Vergleichsverhandlung vor der Rechtsberatungsstelle der DAF gekommen war mit dem Ergebnis, dass Fritz die fristlose Kündigung von Hasché zurücknehmen musste. Dem Untersuchungsausschuss IV lag auch das Arbeitszeugnis vor, das Fritz dem Hasché am 8. Juni ausgestellt hatte und in dem er „gern bestätigte, dass Hasché mit den besten Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Gastronomie ausgestattet ist, seinen Beruf ernst nimmt, dem Personal gegenüber ein energischer Vorgesetzter war und die Interessen meines Hauses mit Hingabe und Pflichtbewusstsein wahrgenommen hat.“[213] Der Untersuchungsausschuss gelangte am 19. August 1946 in dieser Frage unter Punkt 11 daher zu folgendem Ergebnis: „Der Antragsteller ließ durch seinen Angestellten Erich K. den Belastungszeugen Hasché des Diebstahls beschuldigen, um seine Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Laut eingereichter Unterlage ist der Sachverhalt geklärt und es besteht keine Ursache, die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu bezweifeln.“[214] In einem privaten Schreiben an Fritz vom 28. Mai 1934 beklagte sich Hasché: Sie behandeln mich, „Ihren ersten Beamten wie einen Schuhknecht.“[215]
Am 28. Januar 1948, elf Tage nach dem Schreiben von Hasché an den Spruchkammer-Vorsitzenden im Verfahren gegen Fritz, erschien „auf eigene Veranlassung“ der Kaufmann Heinrich K. Kayser, seit 1911 Wein-, Spirituosen- und Zigarrenlieferant der Emil Fritz-Betriebe,[216] vor dem Spruchkammervorsitzenden Otto Lindau, um eine Aussage über Fritz zu machen. Sein Auftritt war überraschend, da das Verfahren sich ja schon über zwei Jahre hingezogen hatte.
Kayser hatte in Sachen politischer Entlastung von Fritz nichts Neues beizutragen. Er beschränkte sich darauf, Fritz eine nicht-nationalsozialistische Einstellung zu bescheinigen und dessen Mitgliedschaft in der NSDAP mit „dem Druck der damaligen Zeit“ zu erklären.
[212] E und D Report („Delinquincy und error report“) der amerikanischen Militärregierung, „special branch, Angestelltenkammer“ vom 6. April 1948 der Investigatoren Hölscher und Zalga. K. war auch nach dem 8. Mai 1945 bei Fritz in Lohn und Brot und bewohnte als Mieter das Gartenhaus im hinteren Teil des Villa-Grundstücks in der Parkallee 109. Abgesehen von dieser wirtschaftlichen Abhängigkeit, hatte er, nach Aussage von Hasché schon Anfang der dreißiger Jahre große Probleme mit dem Alkohol.
[213] Arbeitszeugnis des Willi Hasché, a.a.O.
[214] „Appeal not approved“, a.a.O.
[215] Dok 94.
[216] Diese Angabe machte er selbst. Das Dokument beginnt mit den Worten: „Auf eigene Veranlassung erscheint in Sachen Emil Fritz der Kaufmann Friedrich H. Kayser (…) und sagt folgendes aus.“ 29. Januar 1948. Dok 11.
Seite 74
Im Mittelpunkt seiner Aussage stand gar nicht Fritz, sondern der Belastungszeuge Willi Hasché. Kayser begann seine Ausführungen mit zwei Falschaussagen. Er übernahm die beiden von Fritz schon einmal im Verfahren vorgetragenen Lügen, dass Hasché nur „von 1928 bis 1931“ Direktor der Emil-Fritz-Betriebe gewesen[218] und wegen Diebstahls entlassen worden wäre. Als Direktor des Hotels „Europäischer Hof“ hätte er seit 1936 „dauernd gegen Fritz gehetzt.“ „Als bewussten Racheakt“, sagte Kayser aus, „schritt er zu folgenden Mitteln: Er beauftragte einen bekannten Gestapo-Spitzel, der Name ist mir unbekannt, bot ihm eine größere Summe Geldes an (es handelte sich um einige hundert Mark) und veranlasste diesen Spitzel, die wahre antinationalsozialistische Einstellung des Fritz herauszulocken. Fritz sollte dann auftragsgemäß der Gestapo gemeldet und unschädlich gemacht werden. Fritz war durch mich von dem Vorhaben des Hasché und seines Werkzeuges orientiert. Als der Gestapospitzel seinen Auftrag im „Astoria“ ausführen wollte, nahm in Fritz bei Schlips und Kragen, vermöbelte ihn und warf ihn aus dem Lokal. Monate später erzählte mir Fritz, dass der Gestapomann noch einmal bei ihm gewesen sei. Bei dieser Gelegenheit hat der Gestapospitzel um Entschuldigung gebeten und erklärt, dass er von Hasché zu der Tat angestiftet worden sei.“
Diese haarsträubende Geschichte fand hier, wenn auch nicht in ihren Einzelheiten, nun schon das vierte Mal Eingang in eine Entnazifizierungsakte, aber zum ersten Mal in die von Fritz. Die ersten drei Male wurde sie im Vorstellungsverfahren von Willi Hasché erzählt, der sich wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft seit 1938 zu verantworten hatte, zunächst mündlich, dann am 18. Februar 1947 schriftlich. In der ersten Fassung, die Kayser in einer schriftlichen Bestätigung seiner mündlichen Aussage gemacht hatte, war die Geschichte noch etwas „dürftig“: „Ich kann bezeugen, schrieb er, dass Hasché in der Zeit, wo er das Hotel „Europäischer Hof“ hatte, versuchte, Herrn Fritz zu schaden. (…) Des weiteren sagte mir Hasché, dass er einen Mann gegen Bezahlung gedungen hätte, der als Spitzel gegen Fritz arbeiten sollte, um Fritz in der damaligen Zeit antinationalsozialistischer Äußerungen zu überführen. Zu letzterem Fall wird Herr Fritz selbst schriftlich Stellung nehmen.“ Die entsprechende Aussage von Fritz fand sich drei Tage später in der Hasché-Akte: „In der Zeit seiner Tätigkeit bei mir habe ich bei Hasché immer festgestellt, dass er aus einer gewissen krankhaften Neigung zu irgendwelchen Denucierungen bereit war, die sich gegen andere Angestellte richteten.“ (…) Ein weiterer Fall wirft ein bezeichnendes Licht auf den schäbigen Charakter des Hasché: Es mag im Jahre 1937 gewesen sein, als bei mir ein Mann erschien, dessen Name mir nicht mehr bekannt ist.
[217] Diese Angabe hatte Fritz in seiner schriftlichen Aussage vor dem Untersuchungsausschuss 34 im Vorstellungsverfahren von Hasché am 21. Februar 1947 gemacht.
Seite 75
Dieser schlängelte sich an mich heran, behauptete Gegner der Nazis zu sein (in Wirklichkeit war er Gestapo-Spitzel) und schimpfte auf das damalige System. Ich wurde vor diesem Mann von einem Angestellten gewarnt. Eines Abends bestellte ich einige meiner Angestellten in das Jagdzimmer des „Astoria“ und ließ den betreffenden Mann heraufkommen. Ich stellte ihn zur Rede und entfernte ihn mit Lokalverbot aus meinem Betrieb. Einige Tage später erschien der Mann wieder, bat um Aufhebung des Lokalverbots und gestand mir, dass er mich als Nazigegner entlarven sollte, wozu er von Hasché eine größere Summe Geldes versprochen bekommen hatte. Insbesondere dürfte auch dieser Vorfall die hinterlistige und gemeine Gesinnung des Hasché genügend charakterisieren.“
Aus dem Angestellten, der Fritz noch in der ersten Fassung gewarnt haben soll, war nun der Zeuge Kayser selbst geworden. Und während Fritz in dieser ersten Fassung dem Gestapo-Spitzel nur Hausverbot erteilt hatte, war er ein Jahr später in der Fassung von Kayser „vermöbelt“ worden. Der Spruchkammervorsitzende Lindau nahm die Aussage von Kayser zu den Akten, ohne die Benennung von Zeugen zu verlangen oder eine Frage zu stellen. Er ließ die Diebstahl-Lüge ebenso stehen wie die falschen Zeitangaben zur Beschäftigung von Hasché in den Emil-Fritz-Betrieben.
Die scheinbar harmlose Falschaussage über den Zeitraum von Haschés Tätigkeit ist der Schlüssel für die Verleumdungen und Diffamierungen des Hasché, denn die Geschichte von der „illegalen Abwehrbewegung“ stand und fiel mit dem Fundament der grundsätzlichen politischen Gegnerschaft von Fritz zum Nationalsozialismus von Anfang an. Hasché war der wichtigste Zeuge in der Reihe derjenigen, die Fritz‘ frühzeitiges „Überlaufen“ zu den neuen Machthabern beobachtet hatten. An seinen Aussagen führte kein Weg vorbei, zumal Hasché, im Unterschied zu anderen Zeugen, sich nicht entmutigen ließ, seine Aussagen auch im weiteren Verfahren zu wiederholen. Als Fritz klar geworden war, dass er in Hasché einen „Gegenspieler“ hatte, gegen dessen sachliche, nüchterne, von Dokumenten gestützte Aussagen er nichts ausrichten konnte, griff er zu den Mitteln der Diffamierung und Verleumdung. Mit seinem Spirituosen-Lieferanten hatte er, anders kann man es nicht nennen, eine Rufmord-Kampagne gegen Hasché ausbaldowert. Eine Woche nach der Aussage Kaysers wurde Hasché vor die Spruchkammer geladen, wo man ihm das Protokoll von dessen Aussage vorlas, ohne ihm den Namen des Verfassers zu nennen.[218]
[218] Spruchkammer Bremen, Vernehmung des Hoteliers Willi Hasché in Sachen Emil Fritz. 4.2.1948, Dok „zu 12“.
Seite 76
Hasché wies die Anschuldigung „auf das Entschiedenste“ zurück. „Ich kann von mir nur sagen, dass ich keinen Menschen von der Gestapo gekannt habe.“ Er schloss seine Vernehmung mit dem Satz: „Zusammenfassend kann ich nur immer wieder sagen, dass Emil Fritz ein ausgesprochener Konjunkturjäger ist, der jedem nachläuft, der ihm Vorteile bietet.“ Die Aufzeichnung der Vernehmung ist kurz. Sie umfasst noch nicht einmal eine ganze Seite. Aus den Unterschriften des Protokolls geht hervor, dass sie nicht vom Spruchkammer-Vorsitzenden Lindau persönlich geführt worden war. An ihn wandte sich Hasché einen Tag danach mit einem Schreiben: Die im Protokoll „ausgesprochenen Beschuldigungen sind im vollen Umfang erlogen und so ungeheuerlich, dass ich sie unter keinen Umständen auf mir sitzen lassen kann.“ Er ging noch einmal auf die wiederaufgenommene Diebstahlgeschichte hin und verwies auf die Klärung des Sachverhalts in den Verhandlungen des Untersuchungsausschusses IV. Er sprach von einem „aufgetischten Märchen mit dem „Gestapo-Spitzel“ und betonte „eindringlich, dass ich mich niemals (Unterstrich im Original – d.Verf.) zu hinterhältigen Handlungen verleiten lassen würde, wie sie der Zeuge Kayser wider besseres Wissen schildert.“ Den Namen des Zeugen hatte er durch Zufall, wie er schrieb, „beim Umblättern“ lesen können. Er wehrte sich gegen den Versuch, „mich mit Schmutz zu bewerfen.“ Hier kämpfte jemand mit den Argumenten des Anstands für seinen guten Ruf als Geschäftsmann und Bürger.[219]
Die späte Aussage von Heinrich K. Kayser steht pikanterweise im krassen Gegensatz zu der frühen Aussage von dessen Ehefrau im Vorstellungsverfahren von Hasché vom Frühjahr 1946 (Vorstellungsverfahren Akte Nr. 7469). Sie hatte eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. (In Auszügen:) „Mir ist bekannt, dass Herr Hasché ständigen Schikanen seitens der Deutschen Arbeitsfront ausgesetzt war, die mit allen Mitteln versuchte, ihn zu Fall zu bringen. (…) Auch in der Judenfrage verhielt sich Herr Hasché stets ablehnend gegenüber den Forderungen der Nazi. Mit ist bekannt, dass Herr Hasché sich immer geweigert hat, das Schild „Juden verbeten“ auszuhängen, und dass er bis zuletzt Juden in seinem Hotel beherbergte. Herr Hasché hat durch diese Einstellung sicherlich manchen geschäftlichen Schaden gehabt, denn sein Hotel wurde allgemein als „Judenhotel“ gebrandmarkt. Wir sprachen oft darüber. Herr Hasché meinte, sein Hotel sei ein internationales Haus und stände als solches allen Gästen ohne Rassen- und Religionsunterschied offen.“[220]
[219] An den öffentlichen Kläger der Spruchkammer, betr.: Verfahren gegen Emil Fritz. 5. Februar 1948. Dok K3.
[220] Zitiert aus dem Berufungsschreiben von Hasché gegen seine Einstufung als „Mitläufer“ in seinem Entnazifizierungsverfahren vom 19.5.1948. 1. Juni 1948.
Seite 77
Ihr Ehemann Friedrich hatte noch am 6. April 1948 an das „Ermittlungsbüro des öffentlichen Klägers“ in Sachen Hasché geschrieben: „Ich habe gegebene Veranlassung dringend darum zu bitten, dass ich vor Erledigung der Entnazifizierung des oben Genannten vernommen werde. Ich bitte um meine baldige Vorladung.“ Am 31. Mai zog er seine angekündigte Aussage wieder zurück: „Ich beziehe mich auf Ihre telefonische Vorladung und teile Ihnen mit, dass ich mich aus ganz bestimmten Gründen entschlossen habe, in dieser Sache nicht mehr auszusagen.“ Aus den Akten erschließt sich der Grund für diesen plötzlichen Gesinnungswandel nicht. Möglicherweise fürchtete er den Zorn seiner Frau über seine Falschaussage. Inzwischen lebte das Ehepaar in Scheidung. Hasché blieb auf diese Weise jedenfalls eine weitere unangenehme Auseinandersetzung erspart.
Ein unbeirrbarer Zeuge: Willi Hasché
In der Vorstellungs- und Entnazifizierungsakte des Willi Hasché findet sich – abgesehen von den Aussagen von Fritz und Kayser – kein schlechtes Wort über ihn, weder über seinen Charakter, noch über seine politische Einstellung in der nationalsozialistischen Zeit. Die Aussage von Frieda Kayser passt in eine Vielzahl anderer Zeugnisse. Politisch steht in der Regel das von Hasché geführte „Judenhotel“ im Mittelpunkt – der Europäische Hof, Herdentorsteinweg 49/50. Die Glaubwürdigkeit des Betroffenen hatte auch mit seiner politischen Herkunft zu tun, auf die er und seine Familie stolz waren. Seine zwanzigjährige Tochter Yvonn erinnerte sich in einer schriftlichen Erklärung an die Spruchkammer, dass ihr Vater sie als Zehnjährige nicht zum BDM anmelden wollte und als ihre Mutter es unter Druck doch getan hatte, er dafür sorgte, dass sie den Dienst so oft nicht mitmachte, bis es zu Strafandrohungen kam. „Einer Führerin, die meinem Vater wegen meines Fehlens Vorwürfe machte, hat er ohne weiteres die Tür gewiesen.“ Sie blieb, nach eigenem Bekunden vom BDM „fast gänzlich unberührt.“ Seine Frau Ella führte Beispiele dafür an, wie der Ruf des Hotels als „Judenhotel“ zu erheblichen geschäftlichen Nachteilen geführt hätte, z.B. wenn Ausstellungen der keramischen Industrie auf Intervention einer NS-freundlichen Firma in Bremen nicht mehr im Europäischen Hof, sondern im Nordischen Hof stattfanden. Das „Judenhotel“ hätte sozusagen auf der schwarzen Liste der NSDAP gestanden, was sich auf die fehlende Zuweisung von Zimmern bei offiziellen Tagungen ausgewirkt hätte.
Seite 78
Die Einstellung zur Beherbergung von Juden hätte sich auch nach dem Eintritt ihres Mannes in die Partei 1938 nicht geändert. Dieser wäre aus Besorgnis um seine Familie erfolgt in der irrigen Annahme, dann „frei von Nachstellungen der Partei“ zu werden.
Seine Schwester Frieda berichtete, dass ihr gemeinsamer Vater „ein verdienter Vorkämpfer der Sozialdemokratie (war), bereits unter dem Bismarck’schen Sozialistengesetz ein persönlicher Freund Bebels und Scheidemanns.“ Ihre Erziehung „bewegte sich dementsprechend in jeder Hinsicht im demokratischen Geiste alter sozialistischer Anschauung.“ „Mein Bruder hat im Familienkreise stets davon gesprochen, dass er den Drangsalierungen der Nazis ausgesetzt war, einmal weil er bei allen Gelegenheiten kein Hehl aus seiner antifaschistischen Einstellung gemacht hat und zum anderen, weil er sein Hotel, getreu seiner demokratischen Einstellung, Juden offen gehalten hat, was nicht nur in Bremen, sondern in ganz Deutschland bekannt war.“[221]
Willi Hasché hat es nicht geschafft, den „Mitläufer-Status“ mit dem entsprechenden Sühnegeld von 1200.- DM und der Kostenübernahme für das Verfahren, abzulegen. Da er Berufung eingelegt hatte, kamen für ihn sogar erheblich höhere Kosten von 1650.- DM für das verlorene Verfahren dazu, die letztlich auch im Gnadenweg nur teilweise erlassen wurden. Was ihm blieb, war eine moralische Ehrenerklärung, die der Spruchkammervorsitzenden Willmar Brassel im erfolglosen Berufungsverfahren am 12.August 1948 für ihn abgab (in Auszügen): „Ihr Verhalten gegenüber Juden wird bedenkenlos anerkannt, jedoch lag darin für die Berufungskammer eine Betätigung, die mit ihrem Berufe zusammenhing und rein menschlichen Erwägungen aus einer gesunden Opposition heraus entsprang, ohne die aktive Widerstandsleistung in der gesetzlich gewollten Bedeutung zu erreichen.“ Ihre formelle Mitgliedschaft in der NSDAP und ihr passives (Unterstrich im Original – d. Verf.) Verhalten standen außer Zweifel, jedoch erfüllen sie (…) nicht die strengen Anforderungen, die an den Begriff „aktiver Widerstand“ gestellt werden. Hierunter gehören Beteiligung an einer Widerstandsbewegung, Sabotageakte, Gegenarbeit gegen die Gestapo u.a.“[222]
[221] Aussagen im Vorstellungsverfahren am 15. November 1946 (Schwester Frieda) und im Spruchkammerverfahren am 28. Juni 1948 (Tochter Yvonn und Ehefrau Ella).StAB 4,66-I.- 3189.
[222] Urteil der Berufungskammer im schriftlichen Verfahren vom 12.8.1948. Brassel blieb bei seinem harten Spruch vom 16.7. Dass er hier eine harte Linie fuhr, war ungewöhnlich. Er hatte den Ruf eines „Liquidators“ (Hans Hesse) der Entnazifizierung erworben, weil er in elf von zwölf Fällen Urteile aufgehoben, bzw. selbst abgemildert hatte. Seine Milde dem ehemaligen Innensenator Laue gegenüber wurde schon erwähnt. Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S.162 und S. 414f.
Seite 79
Man kann sich vorstellen, wie bitter es für Hasché gewesen sein muss, dieses Urteil zu verkraften, nachdem Emil Fritz quasi „im Austausch“ für seine Widerstands-Münchhausiade einen Monat vorher, am 8. Juli, von seinem realen jahrelangen Mitläufertum befreit worden war.[223]
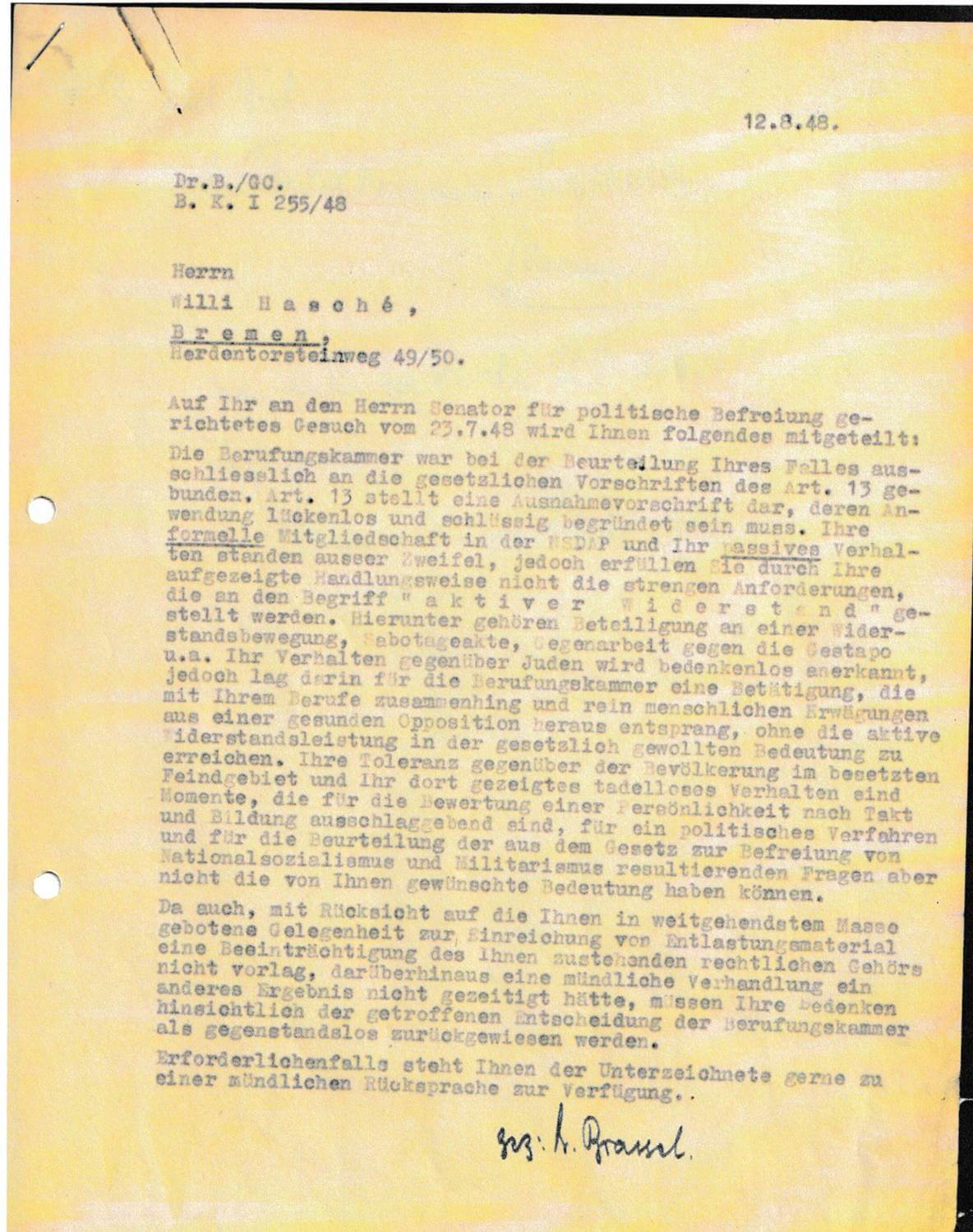
[223] Auch der ehemaligen Direktor Meyer, der von 1930 bis 1936 das Astoria-Kabarett geleitet hatte und 1936 die benachbarten „Hanseaten-Stuben“ in der Katharinenstraße 14 übernommen hatte, musste am 21. April 1948 seine Einordnung in die Kategorie als Mitläufer hinnehmen und ein „Sühnegeld“ in Höhe von 1250. RM bezahlen. Er war am 6. März 1946 wegen seiner frühen Mitgliedschaft in der NSDAP (Juni 1933) im Vorstellungsverfahren als „beschäftigungsunwürdig“ eingestuft worden. Meyer war zunächst mit „Aufräumungsarbeiten“ und „dem Bergen von Steinen“ beschäftigt, wie aus einer Bestätigung des „Arbeitsamtes Bremen NS-Einsatz“ vom 26. März 1946 hervorgeht. Zwei Jahre lang bemühte er sich darum, dass man ihm glaubte, dass Fritz ihn dazu gezwungen hätte, in die Partei einzutreten. Fritz hatte ihm, nach seinen Angaben, mit Entlassung gedroht. Das wäre schon einmal kurz nach dem 31. Januar 1933 geschehen, als Heinrich Himmler mit einigen stadtbekannten SA-Männern Einlass in das „Astoria“ begehrt hatte und Meyer ihnen, weil sie Uniform trugen, der Tradition des Astoria gemäß, den Einlass verwehrte. Zeuge dieses Vorfalls war die damalige Garderobenfrau, die eine entsprechende Aussage vor dem Untersuchungsausschuss machte. Die Entlassungsdrohung bestätigten Hasché und Schuhmann im Verfahren von Meyer. Am 23. April 1946 legte sogar Bürgermeister Kaisen „der Militärregierung zur Entscheidung“ ein Schreiben vor, in dem er zum abgelehnten Vorstellungsgesuch Meyers Stellung nahm (Auszüge): „Meyer hat zu seiner Entlastung zwei Zeugnisse (…) beigebracht, in dem ihm der Vorfall mit Himmler, der nach seiner Angabe zu seiner Kündigung führte, bestätigt wird und in dem ihm bescheinigt wird, dass er sehr unter der Einstellung seines damaligen Chefs zu leiden hatte.“ (Dokument ohne Bezifferung. Es hatte aber keine Wirkung. StAB 4,66-I.-7308.
Seite 80
Wir kommen noch einmal zum Anfang der Geschichte von Willi Hasché zurück. Wir finden in den Akten einen kurzen privaten Briefwechsel aus dem Jahr 1938 zwischen ihm und Emil Staudt, der als sein Vorgänger von April 1930 bis September 1932 Geschäftsführender Direktor der Emil-Fritz-Betriebe war. Hasché muss ihm sein Leid geklagt haben, wie es ihm mit Fritz ergangen war. Staudt, dem Fritz bei seinem Abgang auch vorgeworfen hatte, ihn
bestohlen zu haben, antwortete (Auszüge): „Ich hätte es Ihnen damals sagen können, wie es kommt, aber Sie hätten so wenig geglaubt wie ich, als ich bei meinem Antritt geglaubt habe.“ Er hatte sich die Akten seiner Vorgänger angesehen und war zu dem Ergebnis gekommen: „Wenn man bei Fritz warm wird, er alles aus einem herausgepresst hat und man zu viel weiß, kann man sich auf einen Abgang richten. Entweder macht man es so, dass man geht, oder er kommt mit Gemeinheiten, und dann wird man gegangen. (…) So erging es allen vor mir und nach mir, bis das dicke Ende kam. … gegen solche Machenschaften machtlos (…) Ich sehe nicht ein, dass ich nach 6 Jahren für Herrn Fritz noch zahlen soll. Ich habe in den zweieinhalb Jahren bei ihm genug an Gesundheit eingebüßt, so dass ich heute noch daran zu lecken habe. (…) So andere seine Macht fühlen zu lassen, ist so seine Art. (…) Der ist doch nur durch das Können anderer groß geworden, denn sein Können ist nicht so groß wie sein rigoroser Charakter.“[224] Hasché hatte den Brief dem Untersuchungsausschuss IV übergeben und dazu geschrieben: „Diebstahlbezichtigungen, wie in meinem Falle, sind bei Herrn Emil Fritz typisch. Alle seine leitenden Direktoren sind, wie mir bekannt ist, bei ihrem Abgang von Herrn Fritz des Diebstahls bezichtigt worden. Der Verbrauch an leitenden Angestellten war enorm. Von 1928 bis 1935: die Direktoren Wins, Beileiter, Laats, Staudt, Hasché, Wagenführ.“ [225] Zu ergänzen wären die Direktoren Jungblut (ab 1936) und Völk (ab 1941).
Chronologie der Verfahren bis zum 15. Februar 1948
1945
20. Dezember: Wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft verbietet die amerikanische Militärregierung in Bremen Fritz die Ausübung einer Tätigkeit als Varieté-Direktor und verfügt die Blockierung seines Vermögens. Am 20. Dezember beantragt er ein „Vorstellungsverfahren“ vor einem deutschen Untersuchungsausschuss
1946
25. Februar / 16. März: Erstes Vorstellungsverfahren in Bremen /Untersuchungsausschuss I Krause: Fritz nur nomineller Nationalsozialist / Der Prüfungsausschuss beim „Headquarter Office of Military Government for Bremen – Detachement E2C2“ “ entscheidet am 16. März mit seinem deutschen Vorsitzenden, dass Fritz als „nomineller Nazi“ einzustufen sei. Aufhebung des Berufsverbots und der Vermögenssperre Der Vorsitzende des 45-köpfigen Entnazifizierungs-Prüfungsausschusses (Name unbekannt) hält es „nach Durchsicht der Akten und aufgrund der neu eingegangenen Beschuldigungen gegen Herrn Emil Fritz für notwendig, dass das Verfahren erneut zur Verhandlung kommt.
[224] Brief vom 17. Februar 1938 aus Neuweiler bei Sulzbach/ Saar.
[225] Erklärung von Hasché vom 15. August 1946. Dok 92.
Seite 81
19. August: Zweites Vorstellungsverfahren / Untersuchungsausschuss IV Katz: Fritz typischer Geschäftsnazi; Berufsverbot und Vermögenssperre.
30. August: Entnazifizierungsantrag in der britischen Zone „zwecks Beauftragung mit der Durchführung englischer Truppenbetreuung“; Fritz gibt sein Jagdhaus in Sottrum / Kreis Rotenburg als Wohnsitz an.
21. Oktober: Einreihung in die „Negative Categorie“ („Entlasteter“) durch die Militärregierung in Stade. 4. Dezember Mitteilung an den Rotenburger Entnazifizierungsausschuss, dass sein Vermögen freigegen ist.
1947
24. April: Erste Vernehmung des Zeugen Josef Milos in Rotenburg. Der Vorsitzende der Rotenburger Entnazifizierungskammer Köster erklärt Fritz in einem persönlichen Schreiben zum Widerstandskämpfer und ordnet ihn in die Kategorie V als „Entlasteter“ ein. Kein Hinweis auf ein Verfahren.
9. Mai: Die Bremer Bürgerschaft verabschiedet das „Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“. Ernennung von Friedrich Aevermann zum “Senator für Befreiung“.
19. Juni: Trotz seiner Entlastung in der britischen Zone stellt Fritz einen Entnazifizierungsantrag in Bremen auf der Grundlage des „Gesetzes zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus“ vom 9. Mai 1947.
24. Juni: „Entlastungs-Zeugnis“ (Clearance Certificate)“ des „Military Government 611 DET“ in Stade. Fritz wird nach Verordnung Nr. 79 der britischen Militärregierung entlastet. Bestätigung durch den Vorsitzenden des Rotenburger Entnazifizierungsausschusses.
5. Juli: Auf der Grundlage des Verfahrens in Rotenburg erklärt der Öffentliche Hauptkläger Buchenau die Unzuständigkeit des Bremer Befreiungssenators. Aufhebung des Berufsverbots und der Vermögenssperre. Kassieren des Spruchs durch den Senator für Befreiung Aevermann.
Ende August: Der von Fall Fritz beauftragte Kläger Langer bittet den Entnazifizierungsausschuss in Rotenburg schriftlich um Auskunft über die Gründe für Fritz‘ politische Entlastung.
Seite 82
1. September: Der Rotenburger Ausschuss lehnt die Auskunft ab. Begründung:
Fritz sei „gemäß den Bestimmungen der Verordnung Nr.79 nach den Vorschriften über die Entnazifizierung in der britischen Zone entlastet worden“.
5. September: Der öffentliche Kläger Langer erklärt in einem Brief an Fritz‘ Rechtsanwalt Wentzien die Unzuständigkeit Bremens wegen dessen Entnazifizierung in Sottrum und hebt die Vermögenssperre auf.
8. September: Heinrich Hollmann wird Öffentlicher Hauptkläger als Nachfolger des entlassenen Buchenau.
3.Oktober: Auf Veranlassung von Hollmann widerruft Langer seine Erklärung vom 5. September. Und ersucht die Bremer Militärregierung, Abteilung „Property Control“, die erneute Blockierung von Fritz‘ Vermögen zu veranlassen.
31. Oktober: Hollmann eröffnet ein neues Spruchkammerverfahren gegen Fritz. Begründung: Die Zuständigkeit der Bremer Spruchkammern ist gegeben, da er in den Jahren 1933 bis 1944/45 seinen festen Wohnsitz in Bremen hatte und hier beruflich tätig war.
31. Oktober: In seiner letzten Amtshandlung in Sachen Fritz schreibt Langer an den Entnazifizierungsausschuss Rotenburg. Er übernimmt die Begründung von Hollmann für das Spruchkammerverfahren in Bremen und „ersucht“ den Ausschuss „dringend, das gesamte Material“ aus dem dortigen Verfahren seiner „Dienststelle zuleiten zu wollen.“
6. November: In Umkehrung des Ersuchens von Langer bittet der Vorsitzende des Rotenburger Entnazifizierungsausschusses Senator Lifschütz seinerseits darum, das „in Bremen befindliche neue Belastungsmaterial zur gefl. Einsichtnahme hierher zu übersenden, um die Wiederaufnahme des Verfahrens in Rotenburg in die Wege zu leiten.“
21. November: Alexander Lifschütz wird neuer Befreiungssenator in der Nachfolge von Aevermann.
25. November: Hollmann beauftragt den öffentlichen Kläger Lindau mit der Durchführung eines neuen Spruchkammerverfahrens. Dieser ersucht den Rotenburger Entnazifizierungsausschuss noch einmal, „das gesamte Material“ aus dem dortigen Entnazifizierungsverfahren nach Bremen zu überweisen, da er beabsichtigt, gegen Fritz ein Spruchkammerverfahren einzuleiten.
28. November: Der Rotenburger Entnazifizierungsausschuss antwortet, dass Fritz seit etwa 5 Jahren seinen festen Wohnsitz in Sottrum hat und dass Rotenburg deshalb für seine Entnazifizierung zuständig ist. „Der Fall Fritz ist abgeschlossen. Die Akten befinden sich bei der Militärregierung.“ (Es ist das letzte Mal, dass sich der Rotenburger Entnazifizierungsausschuss im Verfahren gegen Fritz zu Wort meldet.)
Seite 83
1948
31. Januar: Hollmann tritt aus politischer Resignation zurück[1]; sein Nachfolger als Öffentlicher Hauptkläger wird ein Herr Schmidt (Vorname nicht bekannt).
Die Spruchkammer Lindau erteilt Fritz die politische „Absolution“ – Aufhebung des Urteils durch Napoli
Am 17. Februar 1948 erging im Namen des Senators für politische Befreiung das Urteil des öffentlichen Klägers Otto Lindau im Spruchkammerverfahren gegen Emil Fritz, Sottrum, Fährhof 5:
Das Verfahren wird gem. Art. 33 Abs.5 und Art. 31 Abs. 3 eingestellt, das Fritz vom Gesetz nicht betroffen und entlastet ist.[227] Das blockierte Vermögen wird freigegeben.
Wieso Lindau seinen am 25. November 1947 in einem Brief an den Rotenburger Entnazifizierungsausschuss so überzeugend begründeten Standpunkt über die Notwendigkeit einer Entnazifizierung von Fritz in Bremen[228] in seinem Urteil ins Gegenteil verkehrte, lässt sich nur vermuten. Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, dass es unter dem Eindruck der Aussage von Milos geschah, der inzwischen fast so etwas wie eine Attraktion war, wenn er, ohne dass ihm lästige Fragen gestellt wurden, seine Geschichte von der „illegalen Abwehrbewegung“ nacheinander in Rotenburg, vor der Militärregierung in Bremen und jetzt vor Lindau erzählte.
[226] Hollmann, seit Februar 1947 Fraktionsvorsitzender der FDP in der Bürgerschaft, wurde Ende Januar 1948 wegen angeblicher Verbindungen zur KPD aus der FDP ausgeschlossen.
[227] Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 9. Mai 1947. Art. 33, Abs.5: „Der Betroffene ist entlastet oder überhaupt nicht belastet.“ Art. 31, Abs.3: „Die Zuständigkeit der Kammern ist nicht gegeben für Personen, über deren Fall in einer der vier Zonen Deutschlands nach den Bestimmungen der Anordnung Nr.38 des Alliierten Kontrollrats vorher endgültig entschieden worden ist.“
[228] Schreiben von Lindau an den Entnazifizierungsausschuss Rotenburg vom 25.November 1947. Dok zu1
Seite 84
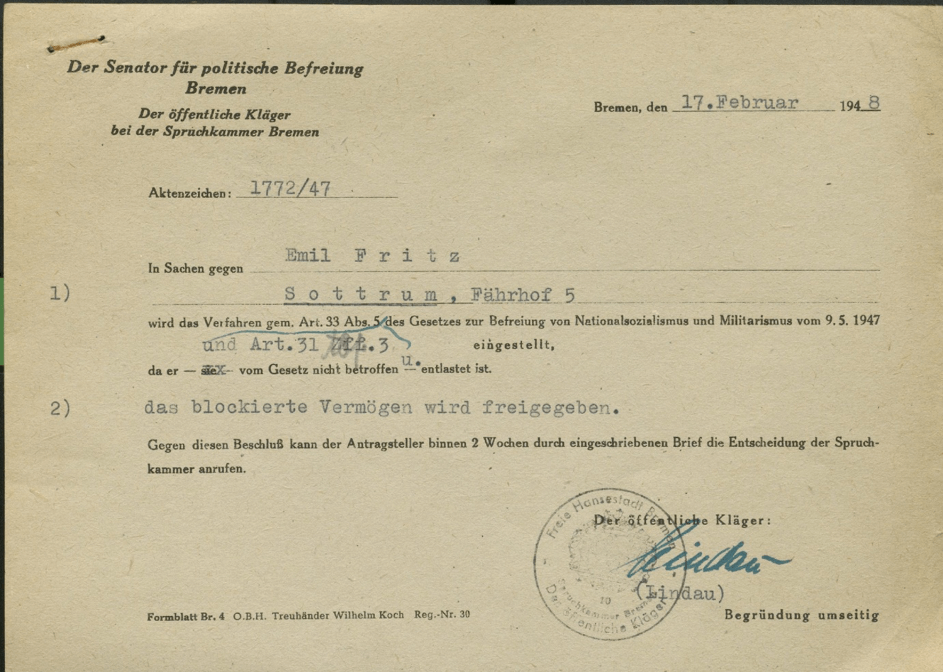
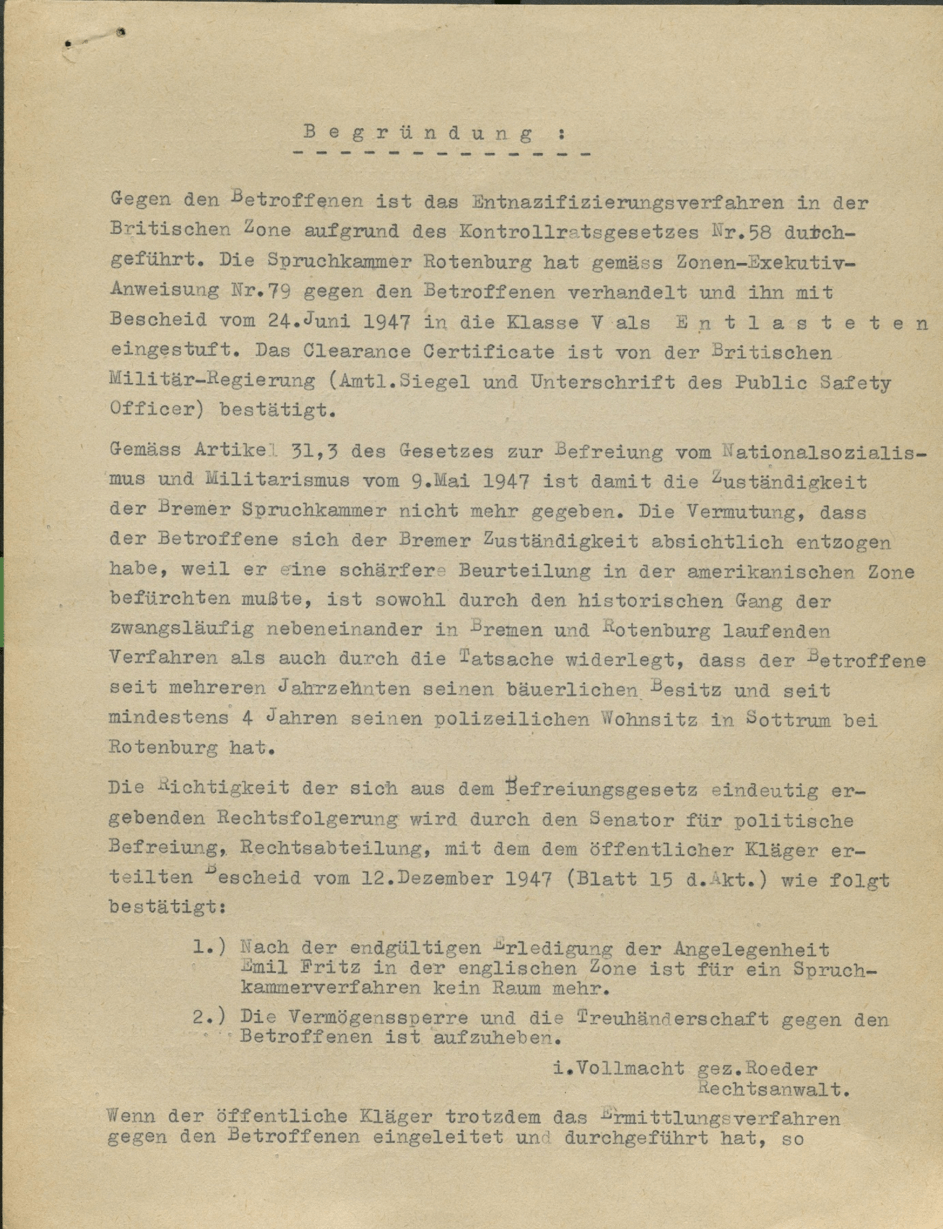
Seite 85
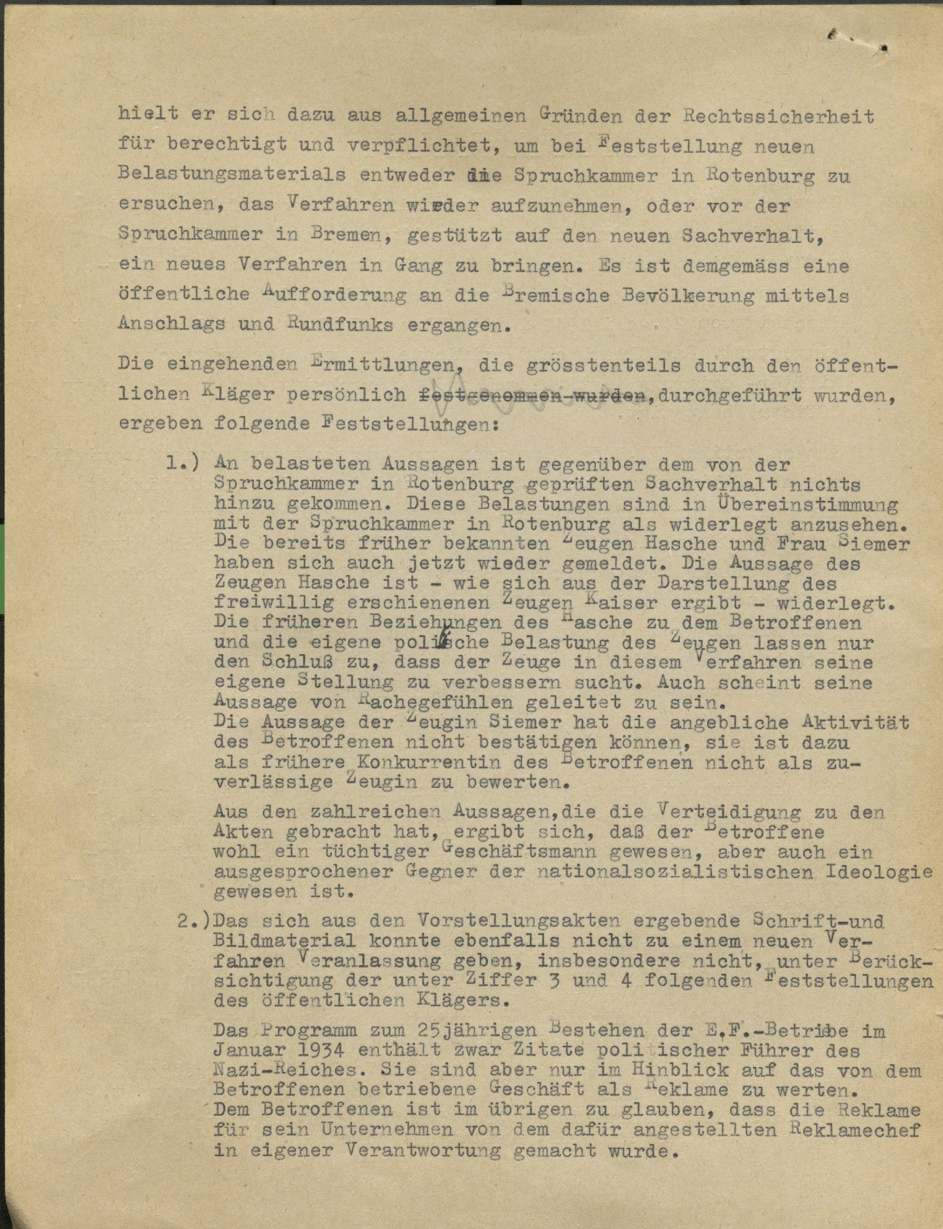
Seite 86
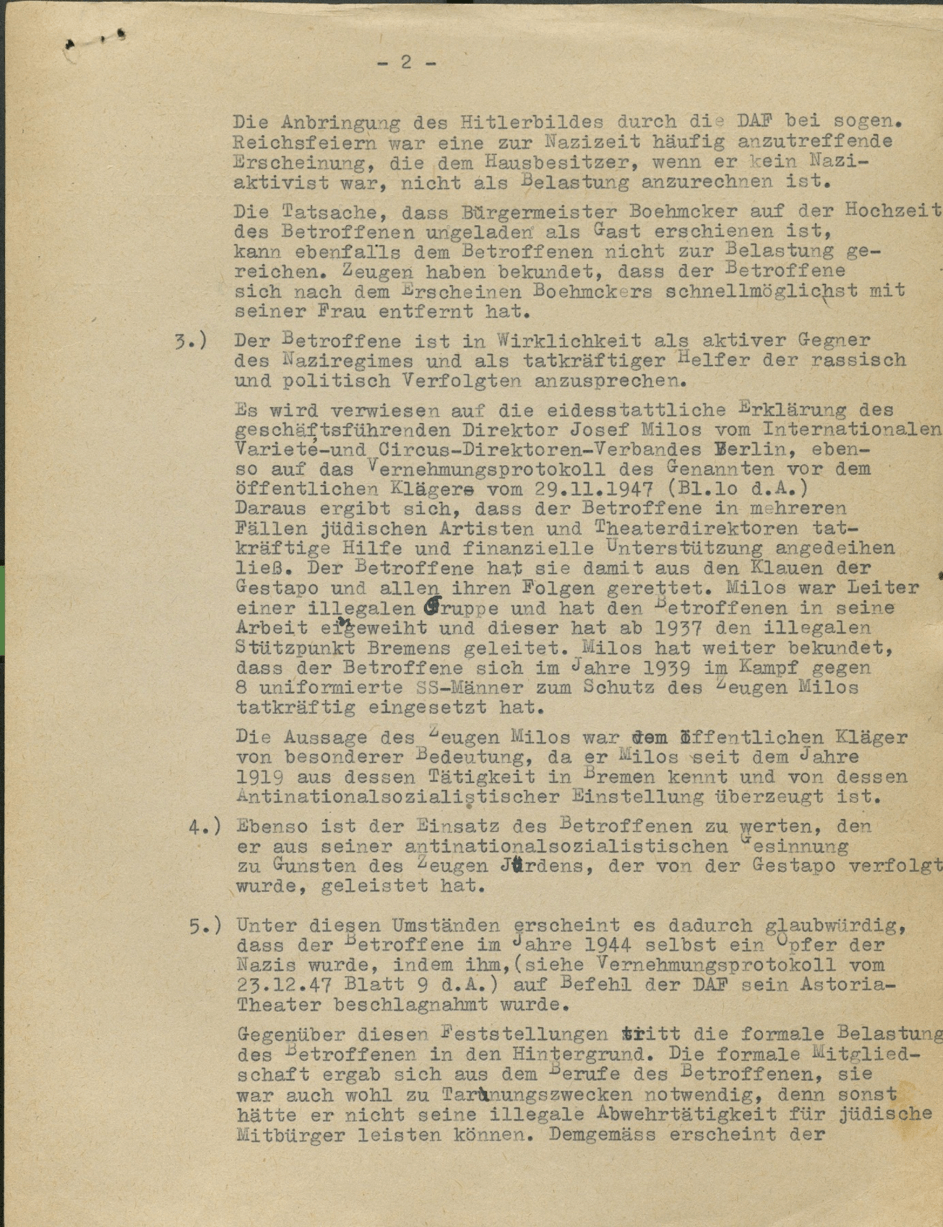
Seite 87
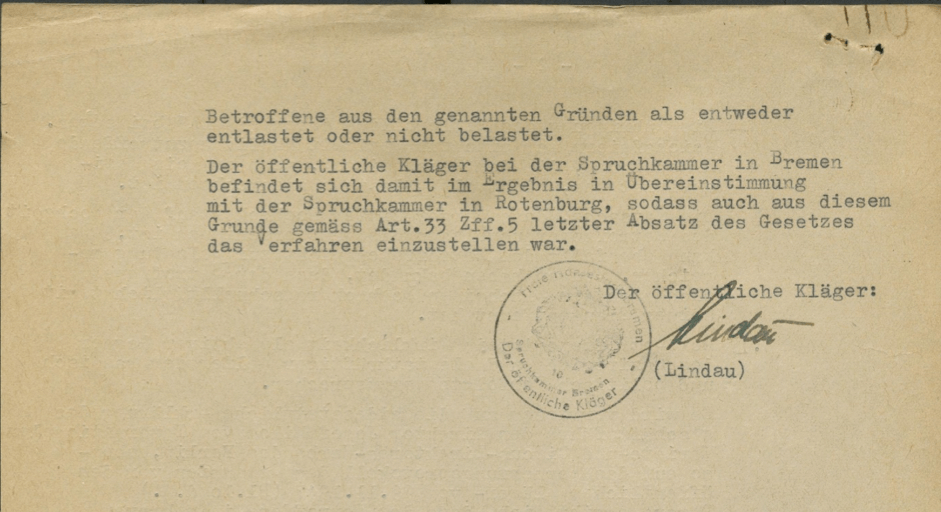
In einem Schreiben an Lifschütz[229] hatte Lindau behauptet, dass sich nach dem öffentlichen Aufruf neue Belastungen nicht ergeben (hätten), „wohl aber wichtiges Entlastungsmaterial (Direktor Maaßen- Milos[230] u.a.)“. Aber Milos war kein neuer Zeuge, sondern seit dem 11. November 1946 fester Bestandteil des Verfahrens. Die Entnazifizierungsakte enthält in der fraglichen Zeit zwischen dem 29. November 1947 und dem Tag des Urteils am 17. Februar keine neuen entlastenden Dokumente; lediglich zwei Schreiben, die sich aber nicht im Urteil niederschlagen.[231]
Das Urteil folgte überraschend in allen Punkten der Argumentation von Fritz. Hier die gröbsten Verfälschungen im Überblick:
1. Fritz hat „in mehreren Fällen jüdische Artisten und Theaterdirektoren (…) aus den Klauen der Gestapo (…) gerettet.“ Im gesamten Verfahren war weder ein Zeuge aufgetreten, der das bestätigt hätte, noch ein Zeuge, der Teil der „illegalen Abwehrbewegung“ gewesen wäre oder ihre Existenz bezeugt hätte. Lindau berief sich nur auf die Aussagen von Milos. Auch für die haarsträubende Räuberpistole, dass sich Fritz „im Kampf gegen 8 uniformierte SS-Männer zum Schutz des Zeugen Milos tatkräftig eingesetzt“ hätte, gab es nur Milos als Zeugen.
[229] „Der öffentliche Kläger an Senator Dr. Lifschütz, im Hause“ vom 29.4.1948.
[230] Milos war sein Artistenname. Sein bürgerlicher Name war Maassen.
[231] In einem Schreiben vom 29. Januar 1948 erklärt ein Herbert Strussalt seine Bereitschaft zur entlastenden Aussage. Die einzige weitere Spur ist ein avisierter Vernehmungstermin für den 3. Februar um 10:30. Das andere Schreiben ist anonym. Darin wird behauptet, dass Fritz ein Duzfreund von Böhmcker war und dass die beiden zusammen mit einem Weinhändler Hans K. Sauforgien und Schlemmereien veranstaltet hättten,, über die der Fahrer und anderes Personal Auskunft geben könnten. Das kurze Schreiben endet mit dem Kurzsatz: „Hass nicht, aber richtige Beurteilung.“ Der Chauffeur von Fritz ist nach Aktenlage nicht befragt worden.
Seite 88
2. „Die formale Mitgliedschaft (…) war auch wohl zu Tarnungszwecken notwendig, denn sonst hätte er nicht seine illegale Abwehrtätigkeit für jüdische Mitbürger leisten können.“ Damit legte der öffentliche Kläger die Aussage von Fritz zugrunde, die dieser am 4. November 1946 bei der Vorstellung seiner „Abwehrbewegung“ gemacht hatte. Sie widersprach zahlreichen anderen gleichlautenden Aussagen zu dieser Frage. Am klarsten kommt das im Urteil des ersten Untersuchungsausschusses zum Ausdruck. Der Vorsitzende Krause war sich sicher, „dass Fritz der Partei lediglich beigetreten wäre, weil er die Zerschlagung oder die Übernahme seiner Betriebe durch K.d.F. nur auf diese Weise verhindern konnte. Seinem Arzt, der am 9. November 1945 für ihn Zeugnis ablegte, hatte er „immer“ versichert, dass er der Partei deshalb beigetreten sei, „um Schaden für sein Geschäft und seine vielen Angestellten zu verhindern.“ In seiner Aussage am 3. Dezember 1947 begründete er sie mit „dem ungeheuren Druck“ der Nazis. In einem Gespräch mit Milos hatte er gesagt, dass er „in die NSDAP habe eintreten müssen, da er immer gefährlicher Bedrohung ausgesetzt worden sei, z.B. Wegnahme seines Betriebes.“ (Erklärung vom 28. Dezember 1946)
3. „Die Aussage des Zeugen Hasché ist – wie sich aus der Darstellung des freiwillig erschienenen Zeugen Kaiser (!) ergibt – widerlegt.“ Kayser hatte in seiner Aussage lediglich die Diebstahl-Version von der Hasché-Entlassung aufgegriffen, die der Vorstellungsausschuss Katz schon im Frühjahr 1946 als Falschaussage identifiziert hatte. Ansonsten nahm er zu keiner Hasché-Aussage Stellung, hatte also auch keine widerlegt.
4. „Das Anbringen des Hitlerbildes durch die DAF bei sogen. Reichsfeiern war eine zur Nazizeit häufig anzutreffende Erscheinung, die dem Hausbesitzer (…) nicht als Belastung anzurechnen ist.“ Dieses Urteil stützte sich auf die Falschaussage von Fritz vom 23. Dezember 1947 vor der Spruchkammer: „Für diese Ausschmückung bin aber nicht ich verantwortlich, sondern die Deutsche Arbeitsfront. Das Bild ist ohne mein Wissen und gegen meinen Willen von dem damaligen Betriebszellenobmann Witte über die DAF angebracht worden. Zu der Zeit hatte die DAF ganz Bremen auf ihre Kosten und ihre Veranlassung mit allen möglichen und unmöglichen Emblemen und Führerbildnissen ausgeschmückt. Wenn ich mich recht erinnere, handelte es sich damals um den ersten Führerbesuch in Bremen zur geplanten Brückenweinweihung.“ Das Ereignis, auf das Fritz anspielt, fand am 1. Juli 1939 in Bremen statt.
Seite 89
Tatsächlich hing das Hitler-Portrait aber am 25. August 1933 am Café Atlantic, anlässlich des Gebietstreffens der Hitler-Jugend in Bremen. Das hatte der Untersuchungsausschuss IV schon im Sommer 1946 festgestellt. In der Reportage über diese Veranstaltung in den Bremer Nachrichten vom 26. August 1933 war das Anbringen des riesigen Hitler-Portraits als private Initiative des Atlantic-Besitzers ausdrücklich lobend hervorgehoben und als Unterstützung für die nationalsozialistische Politik interpretiert worden.
5. „Dass Bürgermeister Boehmcker auf der Hochzeit des Betroffenen ungeladen als Gast erschienen ist, kann ebenfalls dem Betroffenen nicht zur Belastung gereichen. Zeugen haben bekundet, dass der Betroffene sich nach dem Erscheinen Boehmckers schnellmöglichst mit seiner Frau entfernt hat.“ Drei seriöse Zeugen hatten im ersten Vorstellungsverfahren übereinstimmend den normalen Ablauf der Feier bestätigt, wie er sich auch auf dem Foto darstellt. Lindau hatte geflissentlich die widersprüchlichen Versionen von Fritz‘ Darstellung übersehen. Im zweiten Vorstellungsverfahren hatte er noch behauptet, Böhmcker einen Faustschlag versetzt zu haben. Es wäre ein Leichtes gewesen, den wahren Sachverhalt durch erneute Befragung der Zeugen herauszufinden.
6. Dass sich Fritz in der britischen Zone der „schärferen Beurteilung“ in der amerikanischen Zone hätte entziehen wollen, wäre durch die „Tatsache“ widerlegt, „dass der Betroffene seit mehreren Jahrzehnten seinen bäuerlichen Besitz (…) in Sottrum hatte.“ Tatsächlich hatte Fritz in der Sottrumer Gemeinde lediglich eine Jagd gepachtet. Er besaß nur das Jagdhaus in Sottrum, Fährhof
Von einem „bäuerlichen Besitz“ konnte keine Rede sein. Im letzten und rechtsgültigen Spruchkammerverfahren kam der öffentliche Kläger Friedrich Frese dann auch zu dem Ergebnis, „dass der Hauptwohnsitz des Betroffenen, seine Geschäftsunternehmungen, seine wirtschaftliche und politische Betätigung in Bremen war“ und das „alles, was in den Bereich des Befreiungsgesetzes fällt“ in Bremen war.
Seite 90
Neue Ermittlungen – Napoli veranlasst einen „D und E Report“
Das Lindau-Urteil ging so offensichtlich an der Wirklichkeit vorbei, dass Napoli es aufhob und den öffentlichen Kläger Bürgel mit neuen Ermittlungen[232] in einem sogenannten D und E Report (Delinquincy und Error Report) beauftragte.[233] Er hielt Fritz‘ Entlassung aus der Stellung eines Varietédirektors aufrecht.[234]
Aus dem sieben Seiten umfassenden Bericht ergibt sich, dass die Ermittler das Verfahren praktisch noch einmal neu „aufgerollt“ hatten. Zwölf Zeugen, darunter zwei neue, wurden im mündlichen Verfahren an zwei Tagen vernommen, ihre Aussagen in Kurzform protokolliert. Außerdem zogen sie drei „Handakten“ zu Rate mit insgesamt 51 Dokumenten-Seiten, bzw. Fotos., darunter auch die aus dem zweiten Vorstellungsverfahren des Untersuchungsausschusses IV unter Vorsitz von Carl Katz.
[232] Bürgel, über den in den Akten nichts zu finden ist, leitete, wenn man dem Kopf des Berichts folgt, eine „Abteilung Ermittlung“ beim Befreiungssenator. Ob die beiden Ermittler Hölscher und Zalga aus dem Haus des Befreiungssenators kamen oder bei der „Special Branch“ der Militärregierung angestellt waren, ergibt sich nicht aus den Akten. Die Special Branch hatte im Oktober 1945 39 deutsche Mitarbeiter. Vgl. OMGUS Handbuch, a.a.O., S.649.
[233] In den D und E Reports ging es um „corrections of Spruchkammer decisions“. Sie befinden sich in den „National Archives of the United States, die per Schiff in den vierziger Jahren in die USA transportiert worden sind. Teile davon sind auf Mikrofilm im Bremer Staatsarchiv zugänglich. Dafür gibt es einen besonderen Ordner.
[234] Die Mitteilung der Militärregierung an Emil Fritz vom 2. März 1948 geht aus einem Schriftsatz von Rechtsanwalt Wentzien vom 3. April 1948 an den „Hauptkläger“ Schmidt hervor. Das Schreiben der Militärregierung liegt nicht in den Akten.
Seite 91
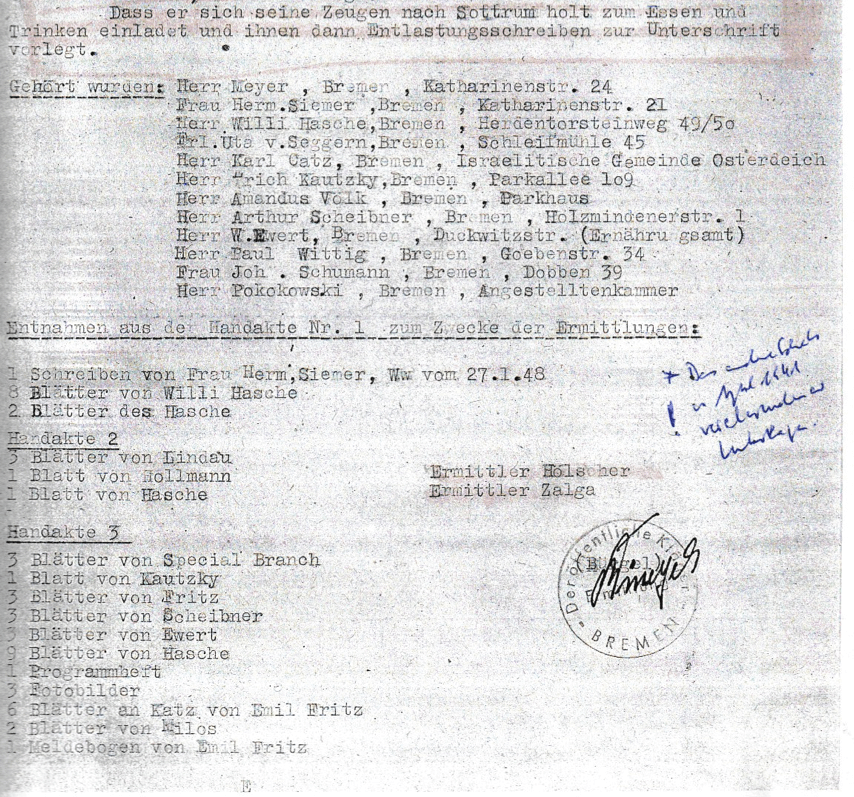
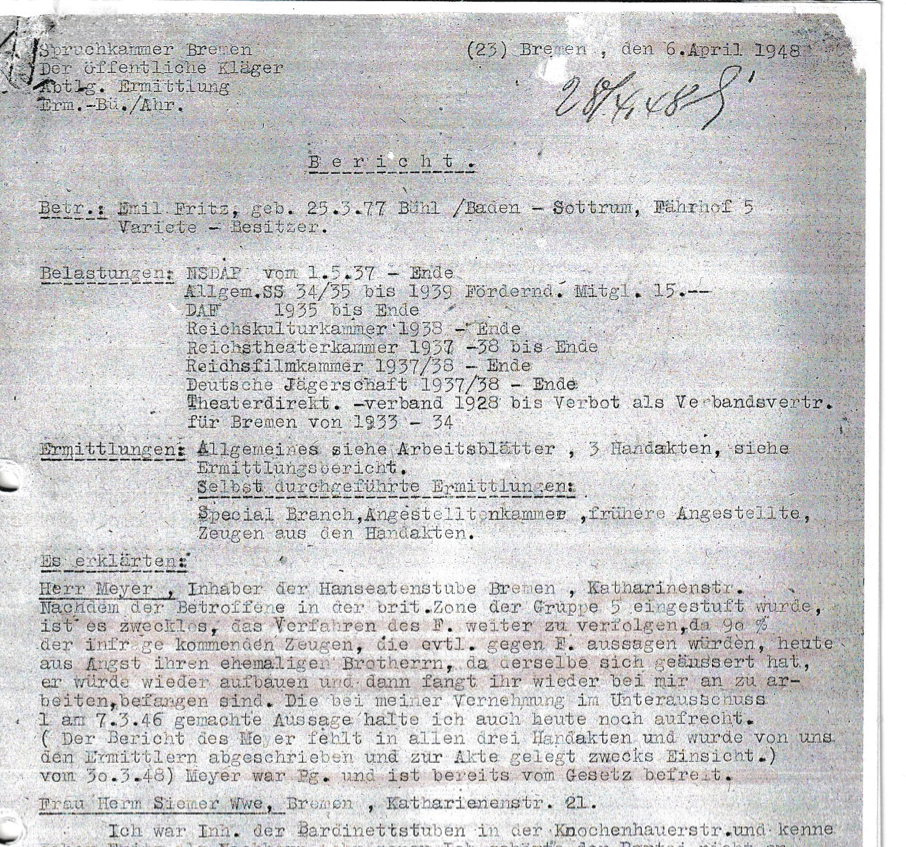
Hier die wichtigsten mündlichen Zeugenaussagen in Auszügen:
Carl Katz, der den Vorsitz im Untersuchungsausschuss IV geführt hatte, war „nichts davon bekannt geworden, dass Fritz Juden über die Grenze geschafft hatte.“ Diese Aussage war von besonderem Gewicht, weil er als Leiter der jüdischen Gemeinde Bremen in den zwei Jahren seit dem ersten Vorstellungsverfahren keinen Hinweis aus der jüdischen Bevölkerung für eine entsprechende Tätigkeit von Fritz erhalten hatte.
Erich K., der Hausmeister von Fritz, der in seinem Gartenhaus in der Parkallee 109 wohnte, gab zu, von den angeblich von Direktor Hasché gestohlenen Lampenschirmen „nichts zu wissen“. Seine eidesstattliche Erklärung wäre „von Frau Paßmann geschrieben worden.“
Seite 92
Paul Wittig hatte zugunsten von Fritz ausgesagt, dass die hohen und ständig steigenden Einnahmen der Betriebe in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre und im Krieg nicht auf Parteivergünstigungen beruhten, sondern allein „konjunkturell“ bedingt waren. Seine Sachlichkeit stand damit außer Zweifel. Die Ermittler bescheinigten ihm dann auch, dass er „sich sehr zurückhaltend zeigte“. Außerdem machten ihn seine lange Dienstzeit als Personalchef und Chef der Buchhaltung von 1932 bis 1945 zu einem wertvollen Zeugen. Das Protokoll seiner Aussage in Auszügen: „Ihm ist bekannt, dass zu den intimsten Freunden des Fritz der Kreisleiter (Bernhard Blanke – d.Verf.) und Böhmcker gehörten, die auch häufig bei Fritz in Sottrum waren und mit Fritz auf Jagd fuhren. Es verkehrten alle Größen der Partei bei Fritz. (…) Die Ausschmückung der Betriebe hat sich Fritz selbst vorbehalten und er ließ sich darin auch nicht dreinreden.
Willi Ewert, seit November 1946 Senator für das Wohnungswesen, Arbeit und Soziales, erklärte, er hätte selbst gesehen, dass in den Lokalen von Fritz „hohe Nazigrößen verkehrten. Auch schon vor 1933. Es war früher Stadtgespräch, dass, wenn die Wagen in schneller Fahrt durch die Stadt fuhren, es hieß, gleich kommt Alarm. Die Nazis fuhren dann zu Fritz nach Sottrum.
Jane Schuhmann, die von September 1932 bis Mai 1934 Sekretärin in den E.-F.-Betrieben war, bestätigte ihre eigenen Angaben vor dem Untersuchungsausschuss IV, dass Fritz schon 1932 einen Betrag von über 1000 Mark an den SA-Standartenführer Theodor Laue, dem späteren Innensenator, persönlich überbracht hätte. Sie ist öfter mit Fritz „zu Nazigrößen gefahren“.
Arthur Scheibner, der Kapellmeister, verwies auf seine Aussagen im Vorstellungsverfahren und lehnte weitere ab. Die ganzen Spruchkammerverfahren hätten doch nicht den Erfolg, den man glauben sollte.
Georg Meyer, einer der ehemaligen Direktoren meinte, dass es doch keinen Zweck hätte, eine Aussage zu machen. 90% der Zeugen hätten Angst davor, ihren möglichen zukünftigen Brotherren zu belasten. Meyers Aussage vom 7.3.1946 fehlte in der Handakte. Die Ermittler machten eine Kopie von seinem Originalbrief.
Auch die Aussage von Frau Siemer, der Inhaberin der benachbarten Bardinet-Weinstube, ging in diese Richtung. Seit Fritz in die Kategorie 5 der Entlasteten eingeordnet wäre, wagten es die Zeugen nicht mehr, gegen ihn auszusagen. Es wäre ihr „nicht erklärlich, dass sie auf ihre Eingabe vom 27.1.1948 an den Kläger bei der Spruchkammer bis heute noch nichts gehört hat.“
Seite 93
Der öffentliche Kläger Lindau hatte es unterlassen, sie als Belastungszeugin vorzuladen. Sie bestätigte ihre in der Eingabe gemachten Aussagen und auch die vor dem Untersuchungsausschuss IV, dass Fritz viel mit Nazigrößen verkehrt und „posiert“ hätte und dass er mit Böchmcker „sehr verwachsen“ gewesen wäre. Hasché, der Direktor von 1932 bis 1934, hielt seine im Vorstellungsverfahren gemachten Aussagen aufrecht.
Fritz im „D und E Report“ politisch belastet
Das Ergebnis war eindeutig:
„Nach Aussagen der Gehörten und anderer Aussagen steht einwandfrei fest, dass der Betroffene von Anfang an mit den Nazis sympathisiert hat und bedeutende Geldbeträge schon vor 1933 zum Aufbau der Partei geleistet hat.“
Im Einzelnen:
„Aus dem anliegenden Programmheft zum 25jährigen Bestehen der E.-F.-Betriebe ist unmissverständlich zu ersehen, dass Fritz es darauf angelegt hat, mit den Führern der Partei in noch engere Fühlung zu kommen, da es viele Zitate von großen Naziführern enthält, u.a. Hitler, Ley, Goebbels, Röhm.“ (Das Heft befindet sich heute nicht mehr in der Akte – d. Verf.)
Viele Entlastungsschreiben sind mit der gleichen Schreibmaschine in Lateinschrift geschrieben, so auch das von Milos. „Wir nehmen an, dass es (…) von hier aus diktiert wurde.“
„Die Einstellung des Betroffenen zur Nazipartei ist auch noch aus einem Schreiben (vom 28. April 1941 – d. Verf.) an die DAF ersichtlich, worin sich Fritz beschwert, dass er wieder nicht zu den ausgezeichneten Betrieben gehört.“[235]
Es ist anzunehmen, dass sich Fritz in der britischen Zone entnazifizieren lassen wollte, „da in der dortigen Spruchkammer seine wahre Einstellung zum 3. Reich nicht genügend bekannt (gewesen) sein dürfte.“
Dass Fritz mehrere SS-Männer niedergeschlagen hätte, ist unglaubwürdig, „denn bekanntlich hätte Fritz (…) Scherereien mit der vorgesetzten Behörde der SS gehabt.“
[235] Es befindet sich nicht mehr in der Akte, stand aber den Ermittlern zur Verfügung.
Seite 94
Das Foto mit der Ausschmückung des Atlantic-Café durch ein Hitler-Portrait von 1933, sowie das Hochzeitsfoto von 1941 mit Böhmcker und Stapelfeldt sahen die Ermittler als Beweismittel an.
„Die in dem Bericht des Milos erwähnten Pasch und Illinger könnte man auch als fingiert bezeichnen, da sich diese Leute bis heute noch nicht gemeldet haben und auch ihre Anschriften fehlten.“ (Pasch und Shelden hatte Milos als jüdische Flüchtlinge benannt; Illinger als Mitglied der Abwehrorganisation – d. Verf.). Wegen des Fehlens jeglicher Zeugen sei die illegale Abwehrarbeit „nicht stichhaltig“. Die Ermittler empfahlen, „in Berlin über Milos‘ illegale Tätigkeit Ermittlungen anzustellen.“
An dieser Stelle seien politische Belastungen von Fritz benannt, die sich in einem parallel verlaufenden Entnazifizierungsverfahren des ehemaligen Fritz-Direktors Amandus Völk ergaben (StAB 4,66-I.-11675). Fritz hatte ihn am 31. März 1941 eingestellt. Völk blieb in dieser Stellung bis zur Zerstörung des Astoria. Bei seiner Bewerbung hatte er sichtbar das Parteiabzeichen getragen, Das dürfte auch ein Grund gewesen sein, dass Fritz ihn engagierte, denn er war zu dieser Zeit darum bemüht, dass die E. und F.-Betriebe als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet wurden, wie wir aus seinem Schreiben an den Hago-Leiter von Hagel wissen. Völk veranstaltete „in Vertretung von Fritz“ regelmäßig nationalsozialistische Betriebsappelle mit Propagandareden und den abschließenden Führerhuldigungen mit dem dreifachen “Sieg-Heil!“ (Aussagen von Paul Wittig und Ernst Jungblut).
In der Akte von Völk findet sich mancher Mitarbeiter der Emil-Fritz-Betriebe, der auch dem Entnazifizierungsverfahren von Fritz als Zeuge gut zu Gesicht gestanden hätte. Zu ihnen gehörten die Kontoristin und Kassiererin Asta Goldberg (1939 bis 1944), die Buchhalterin Nanny Halfmann (seit 1925), der Kellner Rudolf Silter (1928 bis 1940), der Geschäftsführer des Astoria Ernst Jungblut (1936 bis 1939 und- nach der Militärzeit – wieder ab 1941). Einige hatten im ersten Vorstellungsverfahren von Fritz eine schriftliche Erklärung abgegeben. Auch Paul Wittig, Toni Paßmann und Erich K. wurden als Zeugen vernommen. Sie hatten vor dem Untersuchungsausschuss im Vorstellungsverfahren ausgesagt. Auch wenn Völk von der Sache her im Mittelpunkt des Verfahrens stand, stimmten die Aussagen der Zeugen in der Einschätzung des „politischen“ Betriebsklimas der E.-F.-Betriebe bemerkenswert überein. Sowohl im Astoria als auch im Atlantic „verkehrten häufig Gestapobeamte.“
Seite 95
Sie wurden „besonders entgegenkommend“ bedient.“ „In den E.-F.-Betrieben wurden Veranstaltungen der NSDAP durchgeführt.“ (Nanny Halfmann)[236] „Oft waren prominente Vertreter der NSDAP im Astoria anwesend.“ (Asta Goldberg) „Völk hat stets die Belange der NSDAP vertreten“ und Anweisungen an das Personal in diesem Sinne gegeben. (Rudolf Silter, Nanny Halfmann)
Napoli ordnet ein zweites Spruchkammerverfahren an
Noch bevor der D und E Report veröffentlicht worden war, machte Rechtsanwalt Wentzien am 3. April eine Eingabe an den Öffentlichen Hauptkläger Schmidt.[237] Offensichtlich hatte man ihn aus der Rechtsabteilung des Senators darüber informiert, dass der D und E Report ungünstig für seinen Mandanten ausgegangen war. Er legte schon vorab Einspruch ein gegen die erwartete Empfehlung des Reports, Fritz‘ politische Entlastung in der britischen Zone nicht anzuerkennen. Dies wäre, schrieb Wentzien, juristisch unerheblich, weil das Urteil der Bremer Spruchkammer Lindau mit dem der Rotenburger „100%ig“ übereinstimme.
Dann schlug seine Argumentation eine ganz neue Richtung ein. Ihm sei eine „Anweisung des Herrn General Clay an die Militärregierung in Bremen bekannt geworden“, dass keine D und E Reports mehr erhoben werden sollen und sie „soweit ihnen nicht stattgegeben wurde, aufgehoben (sind)“[238]. Grundlage dieser Anweisung sei das 4. Änderungsgesetz des Befreiungsgesetzes vom 25. März in Bremen. Mit diesem Gesetz sei „die Entnazifizierung ausschließlich in deutsche Hände gelegt. Die Überwachung durch die amerikanische Militärregierung ist aufgehoben.“ Tatsächlich konnte der öffentliche Kläger auf der Grundlage dieses Gesetzes die Einreihung der Betroffenen in die Gruppe der „Minderbelasteten“ in einem „Schnellverfahren“ unter Verzicht einer Bewährungszeit vornehmen und die Einreihung in die Kategorie der „Mitläufer“, ohne dass ein Nachverfahren drohte.[239]
[236] Aussage vor dem Ermittler Heinrich Kröplien am 25. März 1947.
[237] Schreiben an den öffentlichen Kläger bei dem Herrn Senator für politische Befreiung, z.Hd. von Herrn Hauptkläger Schmidt, Bremen, Contrescarpe, am 3. April 1948.
[238] Eine derartige Erklärung hat der Verfasser in der einschlägigen Literatur nicht gefunden.
[239] Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 122. General Clay hatte von Bremen den Abschluss der Entnazifizierung am 1. Juli 1948 gefordert. Die Folge der Schnellverfahren war, dass innerhalb von nur vier Wochen 40.000 Bescheide erstellt worden waren. Von 389.000 Meldebogen waren 387.500 bearbeitet. Es blieben noch 1500 schwere Fälle zu bearbeiten. Vgl. Hesse, a.a.O., S.122; vgl. auch Jansen/Meyer-Braun, a.a.O., S.147.
Seite 96
Wentzien begehrte vom Öffentlichen Hauptkläger Schmidt zu wissen, ob der Spruch des Spruchkammerverfahrens Lindau vom 17. Februar nach der neuen Gesetzeslage „nunmehr gültig wäre.“
Schmidt bestätigte die Argumentation von Wentzien schon zwei Tage später in einem Schreiben an Fritz.[240] Die Militärregierung hätte sich „auf Grund einer Anweisung des Herrn General Clay des Rechtes begeben, gegen die endgültige Entscheidung der Spruchkammerbehörde Einspruch zu erheben. Der Entlastungsbescheid des öffentlichen Klägers Lindau vom 17.2.48 hätte daher endgültige Rechtskraft. Fritz unterläge deshalb „keinerlei Arbeitsbeschränkungen mehr“ und sei auch von einer evtl. ausgesprochenen Kontrolle seines Vermögens befreit. Es war, als ob die Besatzungszeit nun beendet wäre. Schmidt hielt es nicht einmal für nötig, Napoli über seine Entscheidung zu informieren. Auf welchem Weg dieser davon erfuhr, erschließt sich nicht aus der Akte.
Seine Reaktion erfolgte erst elf Tage später. Am 16. April schrieb er an den Senator für politische Befreiung Lifschütz und an die Finanzabteilung der Bremer Regierung.[241] Darin erklärte er das Schreiben von Schmidt für „nicht rechtskräftig“. „Unsere Dienststelle reichte einen D und E Report gegen den Entscheid des Spruchkammerverfahrens in der Sache Fritz ein. Bis jetzt haben wir keinerlei Antwort erhalten, welche Schritte aufgrund des D und E Reports unternommen worden sind. Es ist nicht angängig, dass das Amt des Senators für politische Befreiung den von der Militärregierung eingereichten D und E Report, in welchem die Blockierung des Vermögens Emil Fritz (…) für rechtsgültig erklärt wird, übergeht. Wollen Sie bitte veranlassen, dass die maßgeblichen Beamten des Amtes für Vermögenssperre (…) davon unterrichtet werden, dass die Militär Regierung nicht ehermit der Aufhebung der Vermögenssperre von Emil Fritz einverstanden ist, bis das endgültige Urteil von der Spruchkammer gefällt worden ist.“
[240] Schreiben des „geschäftsführenden öffentlichen Klägers“ Schmidt an Emil Fritz vom 5. April 1948.
[241] Schreiben des Büros der Militärregierung, Denazification Division, „an die Finanz-Abteilung“ Betr. Vermögenssperre Emil Fritz, unterzeichnet von Joseph F Napoli, Kopie an den Senator für Befreiung vom 22.Arpil. Die englische Originalversion ist vom 16. April.
Seite 97
Am 23. April erklärte der stellvertretende Befreiungssenator Ernst Karstaedt[242] in einem Schreiben an die Finanzbehörde, dass der Befreiungssenator das Urteil von Lindau aufgehoben „und die erneute Durchführung des Verfahrens angeordnet hat.“ Der Fall sei an eine andere Spruchkammer verwiesen worden. Die Vermögenssperre bliebe bis zum endgültigen Bescheid der Spruchkammer aufrechterhalten.[243]
Mit einem Brief an Lifschütz[244] vom 29. April klinkte sich auch der öffentliche Kläger Lindau noch einmal in die Debatte über die Zuständigkeit der amerikanischen Militärregierung ein. Er beklagte dreifache Aufhebung der Urteile, die nach seiner Überzeugung alle „richtig waren“. Dementsprechend hätte dem „D und E Rapport(!)“ „keine Folge gegeben werden (dürfen).“ Er bat den Befreiungssenator, „seinen Einfluss geltend zu machen“, dass die Militärregierung ihn „zurückzieht.“ Lindau fuhr fort: „Was geschieht, wenn der Verteidiger des Emil Fritz den Bremer Staat vermögensrechtlich haftbar macht für entgangenen Verdienst etc.? Denn es sollen (…) in der britischen Zone bereits wichtige geschäftliche Vorverträge getätigt worden sein.“ Mit dieser Aussage verwandelte er die Entnazifizierung in eine zivilrechtliche Affäre. Er argumentierte ungeniert mit der noch verbotenen beruflichen Tätigkeit von Fritz als Varieté-Direktor. Es war nicht zu übersehen, dass die Autorität der amerikanischen Militärregierung in Sachen Entnazifizierung in Bremen gewaltig erodierte.
Etappen von Fritz‘ NS-„Karriere“
1932/1933
Herbst 1932 Wahlunterstützung der NSDAP mit Spendengeldern; Androhung der Entlassung von Direktor Meyer, der bekannten SA-Besuchern in Uniform den Eintritt ins Astoria verweigert; Druck auf Direktor Meyer, in die NSDAP einzutreten. Frühjahr 1933 Förderndes Mitglied der SS; weitere Geldspenden an die NSDAP. August 1933 Huldigung Hitlers mit einem riesigem „Kinoplakat“ am Atlantic zum Gebietstreffen der Hitler-Jugend in Bremen
1937
25. März Präsident und Vize-Präsident der „Fachschaft Artisten“ in der DAF sind zu seinem sechzigsten Geburtstag aus Berlin angereist, um ihm im Namen der Reichstheaterkammer vor Publikum im Astoria zu gratulieren.
[242] Ernst Karstaedt, 1946 Vorsitzender des Hauptausschusses für politisch Verfolgte, dann Öffentlicher Hauptkläger und ab Dezember 1947 Stellvertreter von Befreiungssenator Lifschütz. Vgl. Hans Hesse, a.a.O., S. 90 und 95.
[243] Schreiben an Regierungsdirektor Dr. Müller, Haus des Reichs. Es ging nachrichtlich an die Denacification Division Joseph F. Napoli, an Emil Fritz, Sottrum Krs. Rotenburg, Fährhof 5, an Rechtsanwalt H. Wentzien, Bremen und an den Öffentlichen Kläger Lindau.
[244] Brief an Senator Lifschütz, „im Hause“ vom 29.4.1948.
Seite 98
31. März Dankesbrief an den Leiter der Hago Bremen, Gerhard von Hagel. 16. April. SA-Gruppenführer Heinrich Böhmcker Regierender Bürgermeister; er wird zum Duzfreund von Fritz; gemeinsame Jagden in Fritz‘ Jagdrevier in der Gemeinde Sottrum. Eintritt in die NSDAP. Übernahme des Amtes eines Vertreters der Fachschaft Artistik in der DAF.
1941-1944
1. März Einstellung des NSDAP-Mitglieds Völk als Direktor.
28. April Brief an von Hagel mit der Beschwerde, wieder nicht als nationalsozialistischer Musterbetrieb ausgezeichnet worden zu sein.Regelmäßige Betriebsappelle mit Propaganda-Reden von Direktor Völk und Hitler-Huldigungen.
